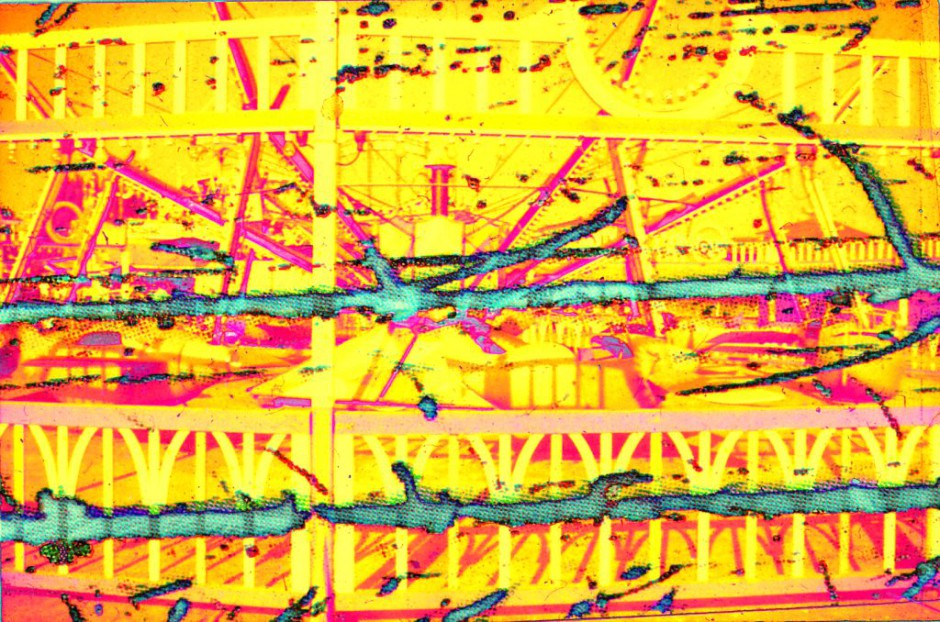Aus dem Wunsch, zu verstehen, geht Einfühlung hervor. Das Denken hat stolpernd und stotternd begonnen. Es haben sich Hindernisse und Konflikte ergeben, überall, im Fühlen und Handeln. Unverständnis, Schwierigkeiten in der Verständigung. Ein arges Holpern im Selbstverständnis wie im Fremdverständnis. Dieses schockierende Befremden, liegt es an den anderen oder liegt es an einem selbst? Das will gewusst werden.
Die einmal gemachte Wahrnehmung des Unverständnisses lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Verständnislosigkeit macht hilflos, macht ohnmächtig. Also müssen Wege gefunden werden, zu den anderen hin, zu sich selbst zurück, Erkenntnismethoden, bei denen die Handhabung des Verstandes nicht ausreicht. Es ist notwendig, ein Stück von sich weg zu gehen, um über dieses Einfühlen verständiger zu sich zurückkommen zu können.
„Sich in das ganze Seyn und Wesen eines andern hineindenken zu können, war oft sein Wunsch – wenn er so auf der Straße zuweilen dicht neben einem ganz fremden Menschen herging – so wurde ihm der Gedanke der Ichheit dieses Menschen, der gänzlichen Unbewußtheit des einen von den Nahmen und Schicksale des andern, so lebhaft, dass er sich oft, so dicht es der Wohlstand erlaubte, an einen solchen Menschen andrängte, um auf einen Augenblick in seine Atmosphäre zu kommen, und zu versuchen, ob er die Scheidewand nicht durchdringen könnte, welche die Erinnerungen und Gedanken dieses fremden Menschen von den seinigen trennte.-“*
Die Menschen sind einander nötig und einander lästig, hilfreich und konkurrent.
Dieses ursprüngliche Ambivalenzverhältnis findet sich bei Kant einprägsam dargestellt. Jedes Individuum ist auf die anderen angewiesen, um seine individuellen Fähigkeiten zur Geltung zu bringen. Gleichzeitig treten die anderen als Konkurrenten auf. Aus Mitstreitern werden im Handumdrehen Gegner.
Gleichgültigkeit gegenüber den Mitmenschen ist der Kompromiss, auf den sich die unsicher fluktuierende Beziehung einspielt. Es ist ein reflektierendes Denken, das dann aus dieser Indifferenz anderen – und daher auch sich selbst gegenüber – heraushilft. Es beginnt mit Befremden und artikuliert sich bald in einer Mischung aus Neugier und Interesse.
Dass diesen Neugierstrebungen und Erkenntnisneigungen Lust und Angst, Scheu und Dreistigkeit beigemischt sind, die darin immer neue Verbindungen und flüchtige Bündnisse eingehen, zeigt die autobiographische Schilderung, die Karl Philip Moritz gegeben hat (1786, also lange vor Beginn der Industrialisierung und vor Poe und Baudelaire, die Jahrzehnte später das Phänomen des Einzelnen in der ‚Masse‘ paradigmatisch beschäftigte).
Von Menschenliebe gibt es in Moritz‘ Bericht kein Spur. Er wird bestimmt von der Frage: was bin ich im Verhältnis zu den unzähligen anderen? wie ähnlich und wie ungleich sind sie und ich? Es findet sich nicht einmal ein artikuliertes Wer, geschweige denn Wir, als vorläufige Einigungsebene. Im durchaus noch kindlichen Grübeln jedoch ist Menschen’liebe‘ als Achtsamkeit, als erstauntes Aufmerken bereits auf dem Wege.
[*] Karl Philip Moritz, Gnothi Sauton oder Magazin zur Erfahrungs-Seelenkunde, Vierter Band, Erstes bis drittes Stück, „Die Menschenmasse in der Vorstellung eines Menschen“, 150ff.