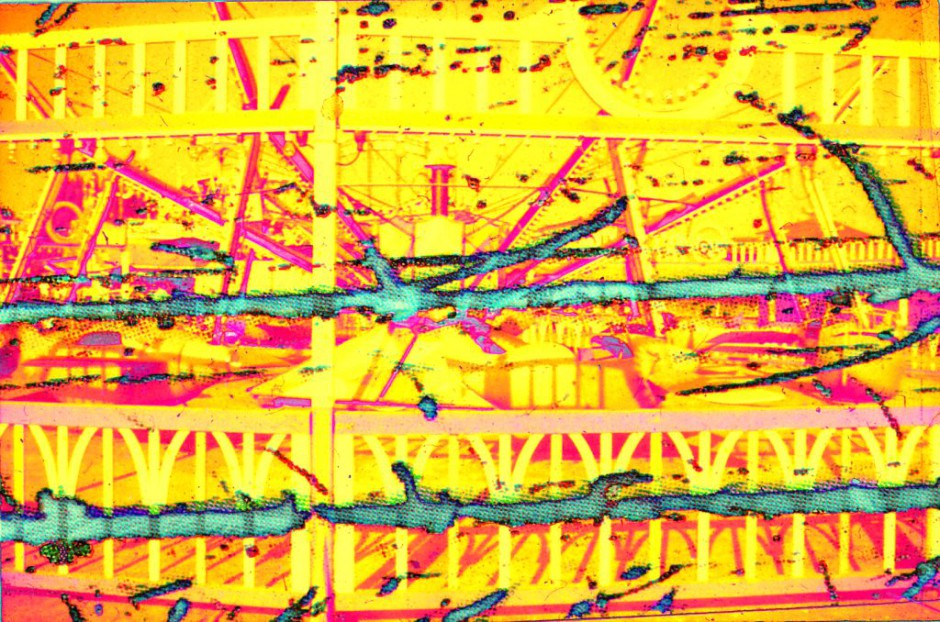zwischen dem ursprünglich unwiderstehlich anziehenden Gesang der Sirenen und der alarmierenden Funktion, die sie in der modernen Welt einnehmen, immer auf den Brand- oder Katastrophenfall lauernd, liegen unüberbrückbare Abgründe.
Dass man die elektrisch betriebenen Lärmquellen, sie stecken irgendwo auf den Dächern und man erfährt von ihrer Existenz nur bei Probealarm, Sirenen genannt hat, geht sicherlich auf einen Irrtum, auf ein schlichtes Missverständnis zurück. Irgendwann müssen die Sirenen als mythische Wesen ausgespielt haben und so unverständlich, so verhasst und dementsprechend auch missgestimmt und übeltönend geworden sein, dass ihr Name auf alle lauten und kreischenden Tonquellen angewandt werden konnte. Dass hier ein Missverständnis, eine Art Hörfehler vorliegt, ist jedenfalls stark zu vermuten.
Verführung liegt seit Anbeginn im Wesen dieser uralten Gestalten, mit denen verführbare Menschen, insbesondere verführbare Männer, seit jeher zu kämpfen hatten. Sie sind der Attraktion der singenden Sirenen erlegen und haben Schiffbruch erlitten beim Versuch, der Quelle dieses Wohlklangs, dem Ursprung dieses bezaubernden Tönens näher und noch näher zu kommen. Sie sind auf Klippen zerschellt, in der Brandung umgekommen und ertrunken im Meer, das die Insel der Sirenen umwogt. Andere, die es übers Ufer der Insel geschafft haben, sind, heißt es, von den Sängerinnen zerrissen worden und zerfleischt. Ihre Knochen bleichen auf den Wiesen, die sich dort ausdehnen, durchsetzt mit wunderbar gedeihendem Krokus, Narzissen und Zeitlosen.
Verführungen mit anscheinend tödlichem Ausgang. Aber wird der Strick dadurch schuldig, dass sich jemand an ihm erhängt? Oder soll man das Wasser tadeln, weil es ertränkt?
Dem im 20. Jahrhundert aufkommenden Schrillen der Warnanlagen und Apparaturen, damals noch elektrisch, heute elektronisch und zum Teil auch schon in künstlichen Menschenstimmen für den Katastrophenfall anweisend, also diesen Gerätschaften hat Kafka eine Geschichte entgegengestellt, in welcher der eigentliche Gesang der Sirenen wieder anklingt. Über Jahrhunderte, über Jahrtausende war er verstummt oder vielmehr unhörbar geworden, wie übertönt von diesem Verstummen, das Kafka wegzog wie ein schwarzes Tuch, so dass darunter das Schweigen sichtbar werden konnte, das Schweigen als die wahre Stimme dieser Wesen. In die Stille dieses Schweigens geht die ganze Fülle menschlichen Wünschens und Vorstellens ein, so dass sie sich daraus vernimmt, diese ewig hypothetische, nach Anhörung und Anschauung verlangende Seele und zurückerhält wie aus einem Resonanzgewölbe, aus einem Überschallraum ihrer geheimen Sehnsüchte, diese ausmachend und zugleich sich damit erfüllend. König Blaubarts Krypta, ins Akustische gewendet.
Nun ist dieses Schweigen eines, das naturgemäß auch sein eigenes Dasein und eigentliches Wesen verschweigt und höchstens einer negativen Bestimmung preisgibt, nämlich der Leere, dem Nichts irgendwie ähnlich zu sein, unbestimmbar und grenzenlos wie die Weite, in die das Verlangen der Seeleute geht, die an den Inseln vorbeirudern, durchs Archipel der Sirenen passieren.
Diese Zusammenhänge oder Motive hat Rilke in einem Gedicht verknüpft, in dem sie zu sehen sind, die Ruderer im Klangraum der Sirenen, „umringt von der Stille, die die ganze Weite in sich hat und an die Ohren weht, so als wäre ihre andere Seite der Gesang, dem keiner widersteht.“[1]
Unter allen Phänomenen, die zeitlebens begegnen und die ein Mensch vom philobatischen oder unendlichkeitssüchtigen Typus des Odysseus unbeirrbar ansteuert, kommen Weite und Tiefe dem Gesang der Sirenen am nächsten. Sie tun sich auf, wenn deren Stimmen von irgendwoher, gegebenenfalls völlig lautlos, erschallen. Es ist also Raum, entgrenzter Raum, der sich aus ihren Kehlen weitet und schiffbar, im weitesten Sinne erfahrbar wird.
Die Stille, die aus den Kehlen der Sirenen singt, ist umrissen von Threnen. So heißen die Trauermelodien, die den Sängerinnen in der Vorzeit einen Platz auf Gräbern und Grüften zuwiesen.
Sie wecken Tränen, aber das Wort kommt von woanders her.
Von Sophokles, dem großen Tragödiendichter, weiß man, dass er eine Sirene an den Ort bestellt hat, an dem er begraben sein wollte. Mit erhobener Klaue und wehendem, im ägäischen Wind aufgelöstem Haar, sollte sie über dem Schlaf dieses Dichters wachen. Sie singt die Stille wie ein mütterliches Wiegenlied, das den Toten sanft in seinem unendlichen Schlaf und Schlummer schaukelt.
Auch Isokrates, der „Vater aller Beredsamkeit“, wie ihn Cicero nennt, wählte das Bild einer Sirene als Grabmal, vielleicht auch in dankbarer Erinnerung an seinen Vater, der in Athen „eine Fabrik von musikalischen Instrumenten besaß und dem Sohne, der 436 v.Chr. geboren war, eine angemessene Erziehung gab“.[2]
Eine Sage aus antiker Zeit weiß, dass sich die Sirenen einst von ihrer Insel, aus ihrem Archipel, das über das weit gespannte Weltmeer zerstreut war, aufmachten und der Mutter Demeter anschlossen bei der Suche nach ihrer in die Unterwelt, ins Totenreich entführten Tochter. Damals opferten sie aus freien Stücken ihre ursprüngliche Mädchengestalt und wurden von den Zehen bis zum Nabel gefiederten Vögeln gleich. Im Fluge meinten sie die Kluft zur Anderswelt besser überwinden zu können.
Vielleicht hat diese traurige und letztlich erfolglos gebliebene Suche nicht nur in ihrem Aussehen, sondern auch in der Weise ihres Gesangs eine Art Spur hinterlassen. Eingeprägt geblieben ist ihnen eine gewisse oder vielmehr völlig ungewiss bleibende Schwermut, in der ihnen Odysseus und erst recht Orpheus, nachdem er seine Eurydike an die Totenwelt verloren hatte, auf rätselhafter Weise, auf gleichsam geschwisterlicher Stufe begegnen und zugleich widerstehen konnten.
In zahlreichen Artikeln wird mittlerweile auch im Internet auf „Sirenen“ verwiesen. Dort wechseln sich die sicherheitstechnischen Instrumente und Warnanlagen dieses Namens ab mit Verweisen auf das Sirenenabenteuer des Odysseus oder auf die Geschichte, wie der große Sänger Orpheus seine Stimme zum Gesang erhob, so dass das Schiff „Argo“ samt seiner aus den größten antiken Helden bestehenden Ladung ungefährdet an der lockenden Gefahrenquelle vorbeischiffen konnte. Ihr Gesang kam nicht an gegen den des Orpheus, der sich samt seiner Leier mitten unter die verbissen rudernde Mannschaft der „Argo“ platziert hatte. Mit ihren Ruderblättern klatschten sie einen Beifall, der alles andere, von innen oder weiter her kommende Tönen ertränkte.
Angedeutet findet man auch den Wettstreit der Sirenen mit den kunstsinnigen Musen. Auch hier mussten jene unterliegen – wer auch immer damals das entscheidende Votum abgegeben haben mag. Ihre Stimmen waren solche der Lockung und Klage, zur Weckung von Sehnsucht, zur Entrückung, aber nicht zum Einsatz in einen Wettstreit gemacht. Ihre Stärke ließ sich in keinerlei Wettkampf erweisen, wie er später etwa in Olympia oder im Sängerkrieg auf der Wartburg ausgetragen wurde. Es war ein anderer Widerstreit, ein anderer agon in den sie all ihre Sangeskraft legten: der Antagonismus von Leben und Tod, eine auf Unendlichkeit gestellte Agonie, die zugleich die Quelle und das Thema ihres Singens abgab.
Die siegreichen Konkurrentinnen erbaten sich von der Jury als Siegeslohn Federn aus dem Gefieder der Verliererinnen. Diese Forderung wurde ihnen gewährt. So rupften die Musen den Sirenen einige der schönsten Federn aus, um sich daraus Kränze und Kronen zu flechten.
Was könnte das Spezifische des Gesangs der Sirenen gewesen sein, den die andere Seite der Stille, die sie sangen, als unvergleichlichen Wohlklang im Innern, in den Lauschern enthüllte?
Zunächst wohl, dass es keine Instrumente dazu gab, weder Harfen noch Trommeln noch Lauten. Da ertönten nur diese Stimmen, die zusammen vielleicht schon eine Art symphonischen oder konzertanten Chor ergaben, aber ohne alle Begleitung. Stimmen, die aus Leibern hervorkamen, die zwar bis zu den Brüsten wie die von großen Vögeln waren, aber nicht aus Schnäbeln, sondern aus Mündern ertönend. Die Hälse die von jungen Frauen, lang, gestreckt und gleichsam gewunden beim Gesang. Es könnte sein, dass die Sirenen auch fürs Auge unsäglichen Charme in ihre Gebärden legten, wenn sie, wie spätere Opernsängerinnen, ihre Arien und Rezitative vortrugen. Liedtext und Melodie spiegelten einander und wechselten sich so ab, dass Verstehen und Empfinden beim Hörer nicht zu unterscheiden waren. Es war eine Musik, die zugleich mit dem Gefühl tiefster oder höchster Erkenntnis und Ergriffenheit einherging, in der die Schranken der Zeitlichkeit, die sich praktisch in jeder Gegenwart aufbauen, eingerissen wurden. Im Vernehmen öffnete sich die Gegenwart für alle erdenklichen und erwünschten Zukünfte, so dass dem Hörenden war, als wüsste er „um ein Neues“, als wüsste er in diesem Wahrnehmen und Genießen um alles, „was irgend geschieht“.[3]
Das Singen rückte oder entrückte die Vernehmenden in ein kosmisches Zentrum, in eine Seinsmitte, in der Künftiges und Einstiges zusammenflossen, eine Mitte, in der alles Geschehen nicht mehr nur akustisch, sondern visualisiert sich einstellt, als Evidenz einstrahlt.
Im Bild des Honigs („honigsüßer Gesang“) erinnert Homer, der selbst Sänger war, der Überlieferung nach blind und somit umso stärker auf innere Bilder bezogen, erinnert Homer an die eigentümliche Verknüpfung von Leben und Tod, von Wehmut und Zuversicht, von Sehnsucht und Trauer, die solcher Musik zugrunde liegt und sie so stark macht, weil Tod und Liebe in ihr sich paaren. „Wir wissen dir alles“, verkünden die Sängerinnen mit Stimmen, „süß wie Honig“, und geben Diesseits und Jenseits als Orte und Regionen nicht nur möglicher, sondern in der Entrückung wirklich werdender Erfahrung. Entrückung als Entzückung.
In jeder Entrückung, Trance und Ekstase liegt ein Gefahrenmoment, eine Bedrohung, die dem gesamten Leben zu gelten scheint, auch wenn sie sich nur auf einen Teilaspekt desselben, auf bestimmte Gewohnheiten, routineförmigen Bahnungen und Mechanismen bezieht. In diesem Moment kommt erneut zur Geltung der Faktor Verführung, der immer wieder mit den Sirenen, beziehungsweise mit ihrem Gesang assoziiert wird und in den gleichnamigen technischen Gerätschaften, deren Anfänge etwa im marinen Nebelhorn liegen, so abrupt und gleichsam höhnisch parodiert und zurückgewiesen wird. Dabei steht doch außer Frage, dass wer sich einmal entzücken oder auch betören lässt, nicht dadurch schon das Leben einbüsst. Bezeichnenderweise erstreckt sich die Warnung der hellsichtigen Zauberin Circe, die ja in Wahrheit diejenige ist, die dem Helden Odysseus die Mittel an die Hand gibt, den Gesang der Sirenen ungefährdet zu genießen, nicht auf Leib und Leben, sondern darauf, dass bestehende konventionelle Bindungen, zum Beispiel an Frau und Kind, in der Entrückung aufgegeben werden, allerdings – oder vielleicht – für immer.
Zur Symbolik des Honigs, die auf eigentümliche Weise aus einer koexistenten Anderswelt in die unsere hinüberreicht, wäre manches zu sagen. Wesentliches davon bringt schon der Ausdruck Honigmond nahe, der unmissverständlich anzeigt, dass in jedem gipfelnden Glück bereits der Abstieg oder sogar Absturz sich ankündigen,[4] ja, dass dieses höchste Liebes- und Lebensglück ohne den darunter gebreiteten Abgrund, ohne die Kehre in eine mondlose Nacht gar nicht zu denken sei.
Abschließend die Frage, ob sich die magischen Sängerinnen ihren Namen selbst gegeben haben oder ob sie ihn aus fremdem Mund erhielten.
Für letzteres spricht, dass es im Hebräischen für Hymnen und heilige Gesänge ein ganz ähnlich klingendes Wort gibt. Es lautet schir. Man würde wohl eher sir akzeptieren. Aber ich denke, den Sirenen ist es anfangs nicht anders als den Ephraimiten gegangen, die auch ihre Schwierigkeiten mit dem Aussprechen des Buchstaben schin hatten und, wie im Buch der Richter zu lesen steht, statt schibboleth beharrlich sibboleth sagten. Das hat sie beim Überqueren des Grenzflusses das Leben gekostet. Vielleicht wollten sie, aber sie konnten nicht anders. Objektiv gesehen und aus dem gehörigen Abstand geurteilt könnte also Schirenen die sprachlich richtige Namensform sein. Es wäre demnach so gewesen, dass die Sirenen im Augenblick ihrer Selbstbenennung, als sie sich ihren Eigennamen zusprachen, für einen Bruchteil dieses Augenblicks fremd wurden. Dass ein Grenzstrom durch sie hindurchschoss und ihr Sprechen, welches dieses einzige Mal kein Singen war, von ihren Lippen nahm und zerriss. Dieser Grenzstrom war der Sage nach Lethe, Strom des Vergessens.
Eine andere Überlieferung weiß: sie haben ihn sich selbst zugesungen, ihren Namen, in der Nacht ihrer Geburt, als der Hundstern, den man später Sirius nannte, wie ein Fanal über den Inseln und den Weltmeeren aufging.
Bei der gegenwärtigen Lage der Dinge wird den mythischen Sängerinnen noch manches schrille Missverständnis vonseiten unserer, von Blaulicht und Katastrophenalarm durchsetzten Dimension widerfahren. Sie werden noch die eine oder andere Feder lassen, gewiss auch im Internet, aus dem man irgendwann einmal Stücke von ihnen wird herabladen können. Aber ihr rätselhaftes Singen, das aus der Stille anhebt und in der Kehrseite der Stille vollendet, kann ihnen kein Mensch, kein Programm, keine Anlage rauben.
abgeschlossen am 31. Dezember 2008
[1] R. M. Rilke, Die Insel der Sirenen, 1908
[2] nach Lübker, Reallexikon des classischen Alterthums, Leipzig 1855, s.v. „Isokrates“, 446
[3] Homer, Odyssee 12. Gesang, 184-191
[4] „Wedded love was compared to the full moon, that soon wanes“, Walter W. Skeat, Concise Etymological Dictionary of the English Language, Oxford 1924, s.v. “Honeymoon”