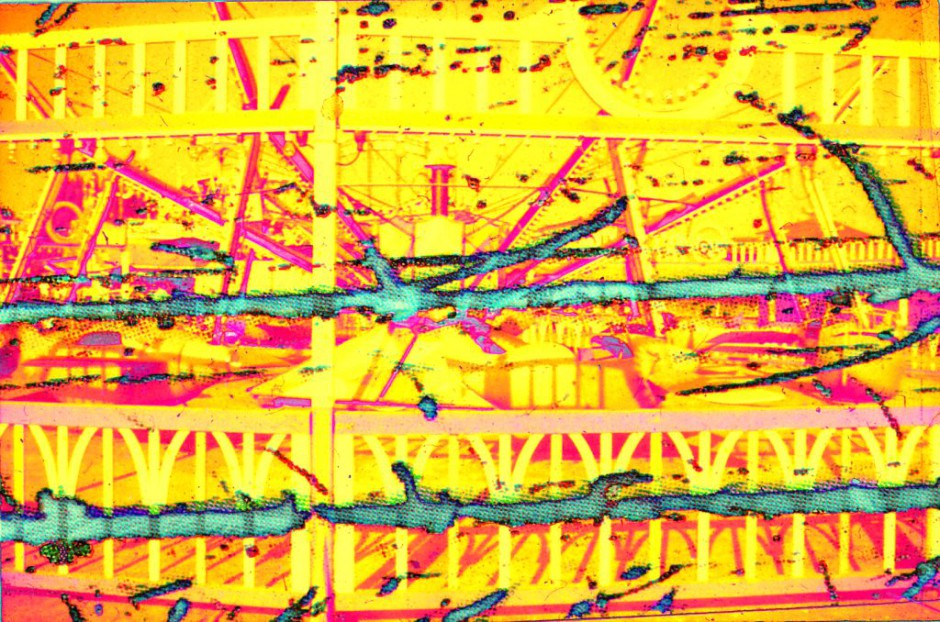Schaubild und Spiegel des Manisch-Depressiven:
Dürers „Melencolia“
Dietmar Becker, 1997
in „Kunst, Therapie und Psychoanalyse“, Festschrift für Elisabeth Wellendorf
Eine Kindheitserinnerung
Als Kind pflegte ich nach Schulschluß meinen Vater aus seiner
nervenärztlichen Praxis abzuholen. Gemeinsam gingen wir dann zum
Mittagessen nach Hause. Wenn ich ins Wartezimmer kam, mußte ich
mich häufig noch gedulden, genau wie die Patienten auch. Ich setzte
mich auf einen freien Stuhl und langte mir eine der herumliegenden
Zeitschriftenmappen (sie hießen „Lesezirkel“). Zwischendurch streifte
mein Blick die anderen Wartenden oder ging auf der gegenüber
liegenden Wand entlang. Dort hing neben anderen Dürerdrucken die
„Melencolia“. Als Kind kannte ich diesen Bildtitel nicht, oder ich
hatte ihn schnell wieder vergessen, weil ich ihn nicht verstand. Das
Bild stand in einem schmalen, dunkelbraunen Holzrahmen, wie die
benachbarten Stiche auch. Da es eine gute Reproduktion war, konnte
man die feinen Punkte und Striche, aus denen sich die einzelnen
Dinge und Erscheinungen des Bildes aufbauten, sehr genau erkennen.
Das faszinierte mich ungeheuer. Aber auch von weiter weg: diese
schwer dasitzende Gestalt, von der sich nicht sagen ließ, ob sie ein
Mann oder eine Frau war. Was tat sie da überhaupt? Und warum
mußte sie da sitzen, wo sie doch Flügel hatte, um damit hoch am
Himmel zu schweben? Aber indem sie so dasaß und ausharrte, leistete
sie denen Gesellschaft, die im Wartezimmer saßen, wie ich.
Depressionen
Es war eine nervenärztliche Praxis. Die Menschen kamen mit den
unterschiedlichsten Symptomen und Beschwerden. Damals gab es kaum
ausgebildete Psychotherapeuten. Daher fiel die Behandlung psychischer
Störungen in die Zuständigkeit des „Nervenarztes“, der – wie
mein Vater – sich auch „Facharzt für Neurologie und Psychiatrie“
nennen durfte. Ich entsinne mich noch sehr gut einer Frau, die wegen
ihrer Schwermutszustände in Behandlung war. Sie litt unter Depressionen.
Frau Holz mochte mich wohl, und ich sie irgendwie auch. Sie
schenkte mir eines Tages ohne ersichtlichen Anlaß, kein Geburtstag,
nichts, eine wunderschöne alte Ausgabe des Robinson Crusoe, mit
Stahlstichen ausgestattet. Die merkwürdige Verbindung von
Verschlossenheit und überschwänglicher Offenheit, von Schwermut und
herzlicher Freundlichkeit, die Möglichkeit eines krassen Wechsels in
Gemütslage und Stimmung ist mir durch Frau Holz beispielhaft vor
Augen gestellt worden. Daß es zwischen ihr und der grüblerischen
Gestalt auf dem Bild an der Wand eine innere Verwandtschaft geben
könnte, kam mir allerdings nie in den Sinn. Ich weiß bis heute nicht,
ob sie Dürers Schaubild melancholischer Verfassung bewußt zur
Kenntnis nahm, ob und was sie darauf sah oder ihr gespiegelt
erschien.
Später habe ich noch ausführlicher und detaillierter über den
Zusammenhang von depressiven Zuständen und sogenannten „manischen“
Phasen erfahren. Ich lernte, daß der Ausdruck „depressiv“ von
„Depression“ herkommt und daß es einen Oberbegriff gibt, unter dem
dieses in sich gleichsam verfeindete Paar zusammengefaßt erscheint:
die Melancholie.
Melancholisch bedeutet also dasselbe wie „manisch-depressiv“.
Allerdings schiebt sich im Alltagsverständnis von „Melancholie“ und
„melancholisch“ merkwürdigerweise immer eher der dunkle, eben
depressiv gefärbte Aspekt in den Vordergrund. Das hängt wohl damit
zusammen, daß in den Depressionen das Leidensmoment stärker zum
Vorschein kommt, als in den Zeiten, wo die manische Komponente
vorherrscht. Dann zeigt sich die Melancholie – alias manisch-depressives
Syndrom – tatsächlich auch als Krankheit. Denn der Ausdruck
Melancholie reicht sehr weit: er findet sich als pathologische und
charakterologische Bestimmung.
Wie alle melancholischen Menschen litt Frau Holz an der depressiven
Seite ihres Wesens. Deswegen kam sie in die Praxis. In ihren manischen
Phasen fühlte sie sich kerngesund. Dann sah ich sie aber trotzdem
manchmal im Wartezimmer, guter Dinge zwischen all den
Kranken und Leidenden. Das war nicht leicht zu verstehen. . Heute weiß ich, sie wollte dem „Herrn Doktor“ triumphierend zeigen, wie
gut es ihr ging. Und schwatzen wollte sie. In ihren manischen Phasen
war das wortkarge Wesen wie weggewischt, wie nie gewesen. Dann
sprudelte es aus ihr hervor, sie war „wie aufgetaut“. Diesen scharfen
Wechsel der Stimmung kennen wir alle aus der eigenen Erfahrung der
trüben Vormittage, die auf eine fröhlich durchzechte Nacht folgen
können.
Der Mann, der eine Frau, die ein Engel ist
Fast ein halbes Jahrhundert danach versuche ich Dürers „Melencolia“
so zu sehen, wie ich sie als Kind an der Wartezimmerwand hängen
sah. Die Hauptfigur ist der Mann, der eine Frau, die ein Engel, die ein
Mann, der eine Frau… ist. Wenn dieser phantasierte Geschlechtswechsel
und dieses Hin und Her zwischen Himmel und Erde mir zuviel
wurde, hielt ich mich vielleicht im Anblick des träumerisch beschäftigten
kleinen Kindes auf dem Mühlstein fest. Aber auch bei diesem
Wesen stand nicht fest, ob es in der Luft oder auf dem Erdboden zu
Hause war. Deshalb geriet der Blick des kindlichen Betrachters sehr
rasch auf die Unordnung und das Durcheinander der im Raum sich
drängenden Dinge. Vieles kannte ich nicht und manches hat bis heute
seinen Namen und seinen Gebrauch nicht verraten. Aber wie durcheinander
lag das da! Das war aufregend, weil ich doch genau wußte,
daß man aufräumen mußte, nach dem Spielen, nach dem Arbeiten
natürlich auch. So hielten es ja auch die Erwachsenen. Im Wartezim-
mer wurden die Stühle zurechtgerückt, was auf dem Boden lag, wurde
aufgelesen oder weggefegt Die Lesezirkel auf den Tischen kamen zu
kleinen Stapeln. Schließlich war alles aufgeräumt Jahrzehnte später
hat mir jemand (es war meine Frau) erklärt, daß es tatsächlich
Analogien gibt zwischen einem aufgeräumten Zimmer und einem
aufgeräumten Menschen, aufgeräumt im Sinne von freundlich, klar und
zugewandt.
Unordnung und Ordnung
Die Unordnung im Bild hat mich damals endlos beschäftigt. Wo
kamen all diese merkwürdigen Sachen, die da herumlagen, bloß her?
Wozu waren die gut? Später, als erwachsener Mensch, wollte ich einmal
ein Verzeichnis der Dinge herstellen, die sich im Bildraum der
„Melencolia“ anfinden. Erstens Name, zweitens vermuteter Verwendungszweck,
drittens sinnbildliche oder sonstige Bedeutung. Viertens:
Assoziationen dazu. Später, als ich erfuhr, daß melancholische Perso-
nen einen Hang zu Pedanterie aufweisen (dazu gehört beim Maler das
sprichwörtliche Zählen der Pinselhaare), habe ich von der Erstellung
solch einer Liste Abstand genommen. Sieht man es spielerisch, ist es
wie Kaleidoskopdrehen. Zwischen den Spiegeln im Sehrohr ordnen
sich die bunten Glasstücke immer wieder anders. Das unterhält und
zerstreut, stellt aber einen Verstand, der das Gemeinsame in den
Dingen sucht, nicht recht zufrieden.
Der Weg
Der Weg, auf dem ich durch diese Seiten führen will, um von Dürers
Melencolia und von unseren eigenen manischen und depressiven
Anteilen ein wenig mehr zu verstehen, ist durch viele Ausleger vor uns
ausgebreitet und gebahnt. Ein Gang durch Dürers Bild ist heutzutage
wie ein Spaziergang zwischen den Füßen des Eiffelturms. Man tut
dies im Bewußtsein der Unzähligen, der unabsehbaren Menschenscharen,
die an dieser Stelle vor einem gestanden und geschaut, sich
gewundert und gerätselt haben. Und: jeder Fremdenführer zeigt und
erzählt anders. Trotzdem bleibt das „sujet“, der Bildgegenstand gleich:
der Eiffelturm, bzw. die Melancholie.
Wie die Mehrzahl der früheren Ausleger, beziehe ich mich zunächst
auf einige Anschauungen, die uns aus der Antike und aus dem
Mittelalter zur Melancholie überliefert sind. Sie sind in der kunsthistorisch
und ideengeschichtlich orientierten Literatur zur „Melencolia“ gut und
reichlich besprochen worden. Manches findet sich auch in Nachschlagewerken,
die sich speziell mit Symbolik, bzw. mit antiker Mythologie
beschäftigen. Aber ich komme nicht umhin, einiges davon zu
wiederholen. Das gehört nun einmal zur besseren Beleuchtung der
Bildidee, um deren Verstehen es uns hier geht.
Schwarze Galle
Die Kenntnis des melancholischen Syndroms reicht bis in die frühe
Antike zurück. Ärzte und Philosophen hielten eine übermäßige
Ausschüttung von schwarzer Galle im Körper für die Ursache des Leidens.
Die Realität dieser Substanz und ihre Wirkung war für die alte
Naturwissenschaft so unbestritten, wie für die moderne Medizin die
des Adrenalins oder anderer körpereigener Hormone oder
„Botenstoffe“ (Endorphine etc.)
Von diesem hypothetischen Körpersaft hat die Melancholie ihren Namen.
„Melas“ ist im Griechischen „schwarz“. Der andere Wortteil geht
auf „cholé“ zurück. „Cholé“ meint ähnlich wie unser Wort „Galle“,
sowohl das Organ, wie auch die daraus abgesonderte Flüssigkeit, dann
aber auch, im Psychischen, „Zorn“, „Grimm“ und verwandte
aggressive Regungen/Erregungen.
Hier ist an den „Choleriker“ zu denken. Dessen Leidenschaften haben
ebenfalls mit dem Gallensekret zu tun. Aber es gibt zwischen dem
cholerischen und dem melancholischen Typus einen entscheidenden
Unterschied: die Cholerikergalle ist in ihrer Färbung gelbgrün ( =
„chólos“), wie bei jedem normalen Menschen auch. Bei der Galle der
Melancholiker setzt jedoch eine Schwärzung, eine quasi biochemische
Umwandlung ein. Dieser Befund ist natürlich nicht anatomisch-
physiologisch zu verstehen, sondern symbolische Darstellungsweise:
Indiz dafür, daß der sonst unmittelbar aggressionsauslösende Gallensaft
durch irgendwelche inneren Bedingungen oder Vorgänge gleichsam
gestaut, in seinem freien Ausfließen gehemmt wird. Die von den anti-
ken Naturforschem natürlich nur vermutete und bildhaft angenommene
Stauung und Schwärzung des Gallensekrets (im Somatischen)
steht in Analogie zu einer, von ihnen am melancholischen Typus
beobachteten Hemmung aggressiver Strebungen im Psychischen. Die
zuletzt genannte Beobachtung wird von der Psychologie und Psycho-
pathologie bis in unsere Tage bestätigt: die für den depressiven
Zustand typische Antriebshemmung, „Leistungshemmung“ (Freud),
„Traurigkeit mit Hemmungsgefühl“ (Kraepelin) umschreiben dasselbe
Symptom auf unterschiedlichen Ebenen.
Saturn, der Planet
Schon gleich zu Beginn der Melancholieforschung in der Antike ahnte
man einen überindividuellen Zusammenhang, eine Begründung des
somatischen Symptoms „Schwarzgalligkeit“ durch ganz elementare
Prinzipien. Diese fanden ihre Verdichtung und kosmologische
Repräsentanz im Saturn. Es fällt jetzt, am Ende des 20.Jh., nicht allen von
uns leicht, diese Setzung nachzuvollziehen. Krankheiten haben mit
Veranlagung, mit Umwelt mit Erregern zu tun. Wie kommen da die
Sterne dazwischen?
Nehmen wir uns also den eigentlichen Verursacher der Stauung und
Schwärzung des Gallensekrets vor, nämlich den oben genannten
Planeten:
Was hat es mit dem auf sich?
Seiner großen Entfernung von der Erde (und der Sonne) wegen
schrieben die alten Astronomen dem Saturn „eine vor Kälte starre
Natur“ zu (Plinius). lamblichus (etwa 250-325 n.Chr.) kennzeichnet
seine Emanationen als „hemmend und lähmend“ (De Mysteriis, 1,18).
Aus heutiger Kenntnis einige Daten zu diesem Himmelskörper:
– er braucht nicht ganz dreißig Jahre, um einen Sonnenumlauf zu
vollenden;
– sieben Drehungen des Saturns um die eigene Achse entsprechen
zeitlich exakt drei Umdrehungen unseres Erdballs
(Ley, Himmelskunde. S.422).
– Eiskristalle bilden den Ring, der für unser modernes Saturnbild
besonders charakteristisch ist.
Die – im Vergleich mit den anderen Planeten – extreme Langsamkeit,
mit der Saturn seine Bahn zieht, war schon im Altertum bekannt. Im
Midrasch rabba wird seine Umlaufdauer erstaunlich genau angegeben:
dreißig Jahre. Den vor-neuzeitlichen Naturwissenschaftlern (oder
besser Naturkundigen) war auch der Zusammenhang zwischen Hitze und
Geschwindigkeit bekannt. Deswegen fragten sie sich: ist der Planet so
kalt, weil er so langsam ist, oder ist er so langsam, weil er so kalt ist?
Die Gelehrten vor Dürer waren da unterschiedlicher Ansicht. Alle
gingen sie von einem Modell unseres Sonnensystems aus, wo nicht
die Sonne, sondern die Erde im Mittelpunkt stand. In diesem geozentrischen
Weltbild gab es die Erde und außerdem sieben Planeten,
unter ihnen die Sonne. Jeder Planet hatte seine eigene Sphäre, die ihn
gegen die je benachbarten Planeten abgrenzte. Der Saturn bildete die
äußerste Sphäre. Die sieben planetarischen Sphären drehten sich
ineinander, wie die Schichten oder Schalen einer aus Schalen
zusammengesetzten Kugel. Die Saturnsphäre (und mit ihr der Saturn selbst)
dreht sich am langsamsten. Der astronomische Befund als solcher war
unstrittig. Nur die Ursachen dieser Langsamkeit bzw. Verlangsamung
wurden kontrovers diskutiert. Aber beide Ansichten stimmen
darin überein, daß sich als Ursache eine Bremswirkung(eben eine
Hemmung) geltend mache. Diese geht vom Firmament (Fixstern-
himmel) aus, innerhalb dessen sich die Saturnsphäre dreht. Kälte und
Trägheit werden also auch im Falle des Planeten auf „höhere Ursachen“
zurückgeführt:
„Plinius spricht, daß ihn der gestirnte Himmel hindert in seinem Umlauf,
und insofern er träge ist, sind auch seine Kräfte (= Einfluß) kalt,
weil schnelle Bewegung eine Sache der Hitze ist Aber Augustinus
spricht…, daß der Stern kalt sei von den Wassern, die über den
Himmeln sind.“ (Konrad von Megenberg 1350 in seinem „Buch der Natur“,
der ersten, sehr populär gewordenen Naturgeschichte in
deutscher Sprache).
Die für das saturnische Wesen charakteristische Hemmung beginnt
also im „gestirnten Himmel über uns“, setzt sich dann über Saturn und
seinen „Einfluß“ auch im Menschen fort, organisch und psychisch.
Die „Langsamkeit“ der saturnischen Fortbewegung korrespondiert mit
der „Schwere“ und Beharrungstendenz, die den melancholischen
Typus (objektiv) und den melancholischen Zustand (subjektiv) kennzeichnen.
Unter den Metallen entspricht dem Saturn das Blei, dessen
alter Name „Saturnus“ lautet. Schwer, glanzlos und matt, in der klassischen
Ordnung der Metalle das unterste, wie Saturn in der klassischen
Ordnung der Planeten der äußerste (bis zur Entdeckung des Uranus,
Ende d. 18. Jh.).
Die astrologische Auskunft
„In der (alten) Astrologie inkarniert Saturn das Prinzip der Konzentration,
der Zusammenziehung, der Festigung, der Verdichtung
(condensation) und der Schwerfälligkeit… Der Name ‚Großer
Übeltäter‘ (Grand Malefique) ist ihm zu Recht verliehen, denn er
symbolisiert Widerstände aller Art, das Anhalten (les arrêts), die
Entbehrung/Enthaltung (la carence), das Unglück, das Unvermögen,
die Lähmung. “ (Chevalier/Gheerbrant, Dictionnaire des Symboles,
„saturne“)
Saturn, der Gott
Wir verlassen jetzt den Planeten, um uns der gleichnamigen mythischen
Figur zuzuwenden. Wer oder was ist im Mythos Saturn?
Zur Beantwortung dieser Frage sind zwei Linien oder Stränge zu verfolgen,
aus denen sich das Saturnbild knüpft, wie es dann zur Zeit
Dürers vorgelegen haben mag.
l. Die römische Variante zeigt Saturn als agrarische Gottheit, die aus
dunkler etruskischer Vorzeit nach Rom gekommen war. Sein Tempel
befand sich am Abhang des capitolinischen Hügels. Dieser diente als
offizielle Schatz- und Dokumentenkammer Roms. In diesem Heiligtum
soll es eine Statue gegeben haben, die den Saturn mit einer Art
Krummmesser in der Hand zeigte. Dieses Gerät – als Winzermesser
gedeutet – weist den Gott als Kulturheros aus, der der einstigen
Urbevölkerung Italiens den Weinanbau beigebracht haben soll. Andere
sehen darin eine Sichel, als Hinweis darauf, daß Saturn darin unterwies,
Getreide zu schneiden und Futtergras, für die Versorgung des
Viehs in der Winterszeit – Kulturtechniken der Vorsorge, der
„Proviantierung“. Darüber hinaus soll er die Menschen, die bis dahin
zerstreut und in großer Furcht vor einander gelebt hatten, das Leben in
Gemeinschaften gelehrt und ihnen die Gesetze gegeben haben, die
gesellschaftliches Leben ermöglichen und auf Dauer gewährleisten.
Zu Ehren des Gottes wurden im alten Rom die Saturnalien abgehalten.
Die dabei beobachteten Festbräuche sollten an eine vorzeitliche Herrschaft
des Saturns erinnern, an das sagenhafte „Goldene Zeitalter“.
Die Leute beschenkten sich. Man tauschte Kerzen aus (die Saturnalien
fanden in der dunklen Jahreszeit statt, etwas vor Weihnachten) und
Lehmfigürchen, die daran erinnern sollten, daß die Abschaffung des
Menschenopfers zu den entscheidenden Neuerungen gehört hatte, die
auf Saturn zurückgingen. Während der Festzeit waren die normalen
Herrschafts- und Dienstverhältnisse außer Kraft gesetzt. Sklaven
genossen dieselben Rechte wie ihre Herren. Es war üblich, daß die
Herren für die Dienerschaft Bankette anrichteten, da es im Goldenen
Zeitalter weder soziale Unterschiede noch solche des Besitzes gegeben
hatte. Zu den Saturnalien gehörte auch reichlich Wein. Auf dem
Lande erhielten die Sklaven eine Extrazuteilung davon. Die Festtage
fielen in eine Zeit, wo die Feldarbeit ruhte und die Kinder Schulferien
hatten. Im Kontext der Melancholie lassen sich die Saturnalien als
eine Institution begreifen, wo manische Ausgelassenheit gleichsam
geboten war und ausagiert werden konnte. Die Saturnalien als kollektives
psychisches Kontrastprogramm zum eher deprimierenden Alltag
der unteren Bevölkerungsschichten. Mit der Erinnerung an das Goldene
Zeitalter sollte auch die tröstende Aussicht auf dessen Wiederkehr
aufrechterhalten werden.
Soviel zum Saturn der Römer.
2. Schon sehr früh wurde der ursprünglich wohl etruskische Saturn
mit dem Kronos der Griechen gleichgesetzt.
Kronos und seine spätere Gemahlin Rhea waren Kinder des Uranos
(„Himmel“) und der Gaia („Erde“). Uranos war eifersüchtig und
fürchtete um seine Macht So wollte er nicht, daß seine Kinder aus
dem Leib der Mutter ans Tageslicht kämen und stieß sie in den Schoß
der Gaia zurück. Als jedoch Kronos geboren worden war, gab Gaia
diesem eine Sichel. In der nächsten Nacht, während Uranos bei Gaia
lag, schnitt der Sohn dem Vater das Geschlechtsteil ab. Danach kam
Uranos nie wieder zu Gaia. Saturns Tat bewirkte also die endgültige
Trennung von Himmel und Erde. Kronos befreite seine Geschwister,
die Titanen, aus dem Leib der Mutter, heiratete seine Schwester
Rhea und trat die Weltherrschaft an. Aus Furcht von einem seiner
Kinder entmachtet zu werden, verschlang Kronos jedes Neugeborene
der Rhea. Schließlich bediente sich diese einer List und reichte nach
der Geburt des Zeus ihrem Mann statt des Kindes einen in Windeln
gewickelten Stein, den dieser verschlang. Als Zeus herangewachsen
war, stürzte er den Vater, durch die Künste der Metis (griech. „Überlegung,
Verstand“) unterstützt. Er zwang ihn, erst den Stein, dann die
verschlungenen Kinder wieder auszuspeien. Danach trat Zeus die
Herrschaft über Götter und Menschen an. Der Stein kam nach Delphi
und wurde zum Grundstein des dortigen Orakels, des berühmtesten
„mantischen“ Heiligtums der antiken Welt. Der Spruch, der über dem
dortigen Tempeleingang gestanden haben soll, ist uns allen bekannt:
„Erkenne dich selbst“. Er kennzeichnet den Ausgangspunkt der antiken
klassischen Philosophie, ebenso wie den der psychoanalytischen
Methode: das menschliche Subjekt nimmt sich zum Objekt. Mit dieser
Setzung gibt sich das Philosophieren aber auch als sublime Form des
Umgangs mit selbstaggressiven Tendenzen zu erkennen – als
melancholische Disziplin schlechthin.
Über das weitere Schicksal des Kronos existieren mehrere Lesarten:
– a. Kronos/Saturn wird von Zeus/Jupiter in den unterweltlichen
Strafort Tartaros geworfen und muß dort bleiben bis in Ewigkeit und
über die Toten Gericht halten.
– b. Kronos wird in den unterweltlichen Strafort Tartaros geworfen,
später aber von Zeus begnadigt und als Herrscher über das Elysium,
das sind die „Gefilde der Seligen“, eingesetzt, eine Art paradiesisches
Jenseits.
– c. Eine weitere Tradition (von Plutarch aufgenommen, vgl. „Das
Mondgesicht“, S.65ff.) besagt, daß Kronos auf eine Insel gebracht
worden sei, sehr hoch im Norden. Dort schläft er in einem Berg, in
einer goldenen Höhle und erträumt die Ereignisse, die künftig geschehen
werden. Geister wachen über ihm, bedienen ihn und bringen seine
Träume zu Zeus, der mit ihrer Hilfe das Weltgeschehen gestaltet und
lenkt („… denn alles, was Zeus im Geiste vorherbestimme, das träume
Kronos..“). Einst wird Kronos wieder erwachen und der Welt das
Goldene Zeitalter wiederbringen. Dann werden die Menschen von
Sorge und mühsamer Arbeit befreit sein. Alles Gute, alle Güter
werden allen gehören, ohne Unterschied von Stand und Geschlecht. Die
Felder bringen ohne Zutun Brot, die Weinberge Wein. Die Menschen
werden von der Mühsal des Alterns verschont sein und friedlich sterben.
Sie werden, vom Leben gesättigt, in den Tod übergehen, der wie
ein Schlaf über sie kommt, vielleicht wie der Schlaf des Gottes in
seiner goldenen Höhle.
Das Goldene Zeitalter, in den Saturnalien inszeniert (und karikiert), ist
also vorzeitliche Mythe und utopischer Entwurf oder Traum für die
Nach-Zeit. Ein manisch-mantischer Gegenentwurf zu den oft eher
bleiern zu nennenden Zuständen diesseitiger Realität und ihren
Entscheidungszwängen, in denen der depressiv gestimmte Melancholiker
sich immer wieder verbannt und verurteilt sieht. In solchen düsteren
Stimmungen ist der Depressive ein kleines Abbild des großen Saturns,
der bis in alle Ewigkeit in der untersten Etage des Universums
eingeschlossen bleiben und dort über Schattenwesen rechtsprechen muß.
Drinnen oder draußen?
Von der Betrachtung der Bildgedanken kommen wir wieder zur
„Melencolia“ selbst, wo diese lange tradierten Vorstellungen und
Sinnzusammenhänge ins Bild gebracht sind. Wir haben ja so etwas
wie eine Übersetzung aus dem Reich gedanklicher, weitgehend
unanschaulicher Abstraktionen vor uns. Hier finden wir einige von den
Elementen und Sinnbildern saturnischer Wissenschaft(en) und Techniken
wieder versammelt, vielmehr zerstreut. Man spürt: unter der
augenfälligen Unordnung verbirgt sich ein System. Spürbar, wenn
auch nicht faßbar.
Es sieht aus wie ein Ausschnitt aus einem sehr bedacht und penibel
arrangierten Bühnenraum. Als hätte ein Dramaturg die gesamte
Requisitenkammer ausräumen lassen und auf die Bühne gebracht. Sein
Ehrgeiz: alles absichtsvoll so erscheinen zu lassen, daß es fürs
Publikum wie zufällig daliegt.
Wie auf der Bühne – also ein Kunstraum.
Nur der Bildhintergrund paßt nicht dazu. Da gibt es eine Wasserfläche,
darüber einen Himmel, ein Himmel mit sehr ungewöhnlichen Erscheinungen.
Links von einer Leiter und zwischen ihren Sprossen sieht man Land
in helles Licht getaucht
Daß die große Gestalt im Freien sitzt hat mich als Kind schon befremdet.
Zu Recht. Dieses Schwanken zwischen Innen und Außen beunruhigt
mich heute noch. Die Unruhe kehrt in alten Frage wieder:
was spielt sich in mir ab? was spielt sich draußen ab, außer mir?
Meinungen, Wahrheiten, Illusionen – in Rätseln und Eingebungen für
Augenblicke enthüllt, für Augenblicke zusammengehalten. Ins
Bodenlose greifende Fragestellungen. Philosophische Fragen (und
Aporien) schlagen wider Willen und widerwillig in psychologische
um Fragen, in denen schließlich das Nachdenken um seine eigenen
verborgenen Ursachen kreist (ähnlich wie Saturn, wenn er weit draußen
auf dem Horizont der planetarischen Welt entlanggeht). Bis dann
Dürers Melencolia bestätigt, ja, das Denken fängt nicht erst im
individuellen Inneren an. Es kommt von weit draußen her. Vielleicht aus
den Himmeln außerhalb unserer Welt mit ihren Planeten (Irrsterne,
Wandelsterne), aus dem „Firmament“ jenseits des Saturns, wo mit
den Fixsternen das Reich der „separaten (= kosmischen) Intelligenzen“
beginnt. Daher fängt das Denken im intraplanetarischen Raum
mit Saturn an.
Erst die Arbeit
Wie bei den meisten Kindern flossen in meiner Phantasie Spielen,
Träumen und Nachdenken zu einem Strom zusammen, von dem ich
mich gerne treiben ließ. Dann hieß es manchmal ärgerlich, wo bist du
bloß mit deinen Gedanken?!“, eine von den klugen Fragen, auf die es
bis heute keine verläßliche Antwort gibt. Sehr widerstrebend übte ich
den verhaßten Spruch ein „Erst die Arbeit, dann das Spiel“. Diesem
Spruch zu gehorchen, ohne überprüft zu haben, was mit Spiel und
Arbeit jeweils gemeint sei, halte ich heute, wo ich die Angelegenheit als
Künstler sehen kann, für einen großen Fehler. Und trotzdem handle
ich nach diesem Grundsatz, heute wie morgen. Ich beobachte andere
Menschen, die ebenso vorgehen und darauf schwören. Sie sagen, das
Unerledigte läge sonst wie eine Last auf der Seele. Darunter leide das
Spiel.
Damals, als Kind, habe ich den Unterschied zwischen Spiel und Arbeit
akzeptiert und mir zueigen gemacht. Arbeit bedeutet Anteil an der
Erwachsenenwelt, aus der sich das Kind ausschloß, so lange es nur
spielen wollte. Kinder spielen, Erwachsene arbeiten. Kinder dürfen
spielen, Erwachsene müssen arbeiten. Für Arbeit gilt: man muß sie
sehen können Unsichtbare Arbeit gibt es nicht. Unsichtbares Spielen
schon: Träumen, Tagträumen und Nachdenken, vom Sinnen übers
Planen bis zum Grübeln, das sind unsichtbare Formen des Spielens.
In der Schule lernte ich, daß unter bestimmten Umständen Arbeiten
ebenfalls unsichtbar bleiben können: beim Auswendiglernen zum Beispiel.
Um zu lernen, mußte man immer und immer wieder üben – ein
verdrießliches Geschäft. Weder Spiel noch ernstzunehmende Arbeit,
stumpfsinnig, unproduktiv, ewige Wiederholung – eines lebendigen
Menschen eigentlich unwürdig.
„Viel Üben macht melancholisch“
So ähnlich mag auch Dürer eines Tages empfunden haben, als er
niederschrieb „Viel Üben macht melancholisch“. Wir stellen uns naiv
und fragen: für einen Künstler wie Dürer, was bedeutet da „üben“?
Bei seinem Genie – hat er das nötig gehabt?
Genau 130 Jahre nach der Entstehung der „Melencolia“ (1514) rät der
Sinngedichtverfasser Martin Opitz
„Stets übe deine Kunst
ist sie dir gleich bekannt;
das Denken stärkt den Sinn,
das Üben stärkt die Hand.“
Übung ist kein Selbstzweck, sondern erfolgt unter dem Anspruch
einer kontinuierlichen Verbesserung. Nicht nur die Arbeit, bzw.
deren Ergebnis oder Produkt, soll verbessert werden,
sondern in den Prozess der Verbesserung ist der Übende selbst
einbezogen, und zwar mit Haupt und Hand. Übung ist der Weg zur
„Meisterschaft“. Gilt das auch in der Kunst?
Wer ein Meisterwerk wie die „Melencolia“ zustandebringt, muß in der
Kupferstichtechnik lange geübt haben. Schon zu Lebzeiten galt Dürer
als unumstrittener Experte in diesem Verfahren. Ein langsames
Verfahren, wo das Material keine leichte Hand duldet, sondern zu
Bedacht und Geduld zwingt. Kein Zufall, daß sich Dürer für diese
widerständige Art der Herstellung seiner „Melencolia“ entschied.
„Saturn symbolisiert Widerstände aller Art“, s.o. Tatsächlich hat es
eine große Bedeutung – das wissen wir aus der kunsttherapeutischen
Arbeit – ob jemand – bei freier Verfügbarkeit der Malmittel – Bleistift
wählt oder Pinsel. Auch zwischen Holzschnitt und Kupferstich
liegen Welten (obwohl beiden gemeinsam ist, daß sich von der einmal
geschaffenen „Matrix“ beliebig viele Abzüge herstellen lassen).
Übung und künstlerische Arbeit zielen bei Dürer – und seither
vielleicht bei den meisten neuzeitlichen Künstlern, jedenfalls bei
allen melancholisch gestimmten – nicht nur auf das Kunstwerk, also auf die
Fertigung eines Kupferstichs im vorliegenden Fall, sondern verfolgen
in der Person selbst ein Ziel, das bewußt oder unbewußt sein kann.
Häufig geht es dabei um die Annäherung an eine Utopie, die Freud
mit dem Begriff Ichideal gekennzeichnet hat. Übung macht sich immer
wieder anheischig als der Weg dorthin. Übung, nicht Arbeit, denn
Arbeit hat noch einen anderen Sinn als Übung. „Wer nicht geübt ist,
versteht wenig“, übersetzt Luther aus dem Buch Sirach (Sir. 34,10).
Daß die auf dem Bilde herumliegenden Gerätschaften des Dürerstichs
immer auf Arbeit hin ausgelegt wurden, hat seine guten Gründe. Aber
ihr Arrangement verrät einen unprofessionellen Umgang mit ihnen.
Eher sieht es aus, als hätte da jemand endlos probiert, studiert und
manisch geforscht – um schließlich irgendwo angelangt zu sein, wo
nichts mehr geht, wo das Bewußtsein in höchster Konzentration den
Punkt zu fassen sucht, in dem die Utopie verschwunden ist. Immer
auch das Bemühen, die Beschwingtheit und inspirierte Begeisterung,
das kreative Glück und Glücken der manischen Phase „künstlich“
wiederherzustellen, die Verfassung also wiederzuerringen, in der – wie
Freud bildlich sagt – das Ichideal im Ich aufgelöst ist.
Zu den neuen Lehren zur Melancholie, die in der Renaissance und in
der Zeitgenossenschaft Dürers Verbreitung fanden, gehören vor allem
die des italienischen Philosophen Ficino.
Nach seiner Auffassung entscheiden nicht nur Geburt und angeborenes
Talent, ob jemand zum Melancholiker wird, sondern ausschlaggebend
kann auch die geistige Ausrichtung sein, in Verbindung mit der
(beruflichen) Tätigkeit, die ein Mensch ausübt.
Dürer war wohl der erste Künstler, der von diesem Theorem nicht nur
angesprochen war, sondern mit der von einem Philosophen vorgeschlagenen
Grenzüberschreitung Ernst machte. Er ließ sich von Saturn
adoptieren, nicht nur als Individuum, sondern als Vertreter seiner
Zunft, der Maler.
Eine Entscheidung, die zeigt daß die Kunst, bis dahin unter dem Pa-
tronat des Merkurs stand ( = Malerei vermittelt die Erscheinungen
durch erscheinungsgetreue Wiedergabe, ist reproduktiv, aber nicht
kreativ) über ihre bisherigen Grenzen hinaustritt. Sie nähert sich
deutlich den exakten Wissenschaften (Geometrie) an, zum Beispiel in der
Betonung der Proportionenlehre und der perspektivischen Darstellung.
Überhaupt verstärkt sich unter dem Zeichen des Saturns eine intel-
lektuelle Tendenz. Der Künstler versteht sich mehr und mehr als For-
scher, als Experimentator, dessen in der Kunstproduktion
gewonnenen Erkenntnisse denen, die die Astronomen aus dem Himmel
und die Physiker auf der Erde, aus der Materie erhalten, gleichrangig
sind. Die Weisheit des Saturns soll auch die der Künstler
werden. Sogar als eine solche Proklamation läßt sich Dürers Sinnbild
auffassen. Deswegen vielleicht der Rückgriff auf eine Technik, die
dem Werk und den darauf dargestellten Anschauungen zu einer weiten
Verbreitung verhelfen sollte. Zugleich liegt in Dürers Bekenntnis
zum Saturnischen eine Art Akzeptanz des damit notwendig einhergehenden
melancholischen Schicksals. Also auch eine heroische Geste
des Künstlers.
Hier kehrt uns das neue Selbstbewußtsein noch eine andere Seite zu:
zur Fertigkeit, die die Hand im Üben erwirbt, tritt eine intellektuelle
Entschiedenheit hinzu: „Was ich bin, das entscheide ich mit“. Geburt
hin, Anlage her. Genie, das man in der Renaissance noch ausgeprägter
als zuvor mit Melancholie verknüpft sah, erscheint als erwerbbar.
Oder vorsichtiger gesagt: die saturnische Utopie leuchtet seit Dürer
auch den Künstlern auf.
Worin besteht diese Utopie?
Wo gibt es sie in den Überlieferungen, auf die sich Dürer bei der
Konzeption seines Bildes eingelassen haben könnte?
Wo finden wir Anzeichen für diese Utopie in unserem Stich?
Saturnischer Schrecken und saturnische Utopie
Im Mythos sind dem von seinem Sohn gestürzten Saturn drei Exile
bereitet Ich habe sie oben schon genannt:
– a. Richter über die Toten im Schattenreich der Unterwelt;
– b. königliche Herrschaft in Elysien, der jenseitigen Region der
erlösten Seelen;
– c. Träumer in einer Höhle, in einem Berg, hoch oben im Norden.Diese Exile der antiken Überlieferung lassen sich verstehen als sinn-
bildliche Darstellungen der beiden kontroversen Komponenten, die
Melancholie ausmachen: die manische und die depressive. Dabei entspricht das „Richten“ in der „Unterwelt“ den schweren, von
Schuldgefühlen und Strafangst begleiteten Zuständen, die sich –
psychoanalytisch gesehen – aus der Spannung zwischen dem Ich und
seinem Ideal ergeben, dessen Anklagefunktion nun das Gewissen
übernimmt. Klage, Anklage, Bestrafung sind auf dieser Stufe des
Exils vorherrschend. Sie lassen sich als aggressive Strebungen fassen,
denen die melancholische Person in sich selbst ausgesetzt ist.
Als Gerichtssymbol hat Dürer die Waage in sein Bild aufgenommen.
Da es um Zurechnung und Straf-Maß geht, berühren sich im Prinzip
strenge Gerechtigkeit und rechnerisches Wesen, wie es in Geometrie
und Meßkunde zu Ausdruck und Gebrauch kommt.
Das melancholische Selbstbild des Königs im Reich der Erlösten
befindet sich auf einer ganz anderen Ebene. Eine ganz andere Tönung
und Stimmung: die Person ist zwar auch in dieser Allegorie hierarchisch,
soviel bedeutend wie: ich bin in mir König, ich bin in mir Untertan –
aber es ist eine Untertanenschaft aus freien Untertanen
(„erlöste Seelen“).
Als Andeutungen einer höheren Freiheit kommen die Flügel der gro-
ßen sitzenden Figur in Frage, und die des Kindes auf dem Mühlstein.
Die dritte Form des saturnischen Exils ist ein Gleichnis des
melancholischen Menschen als eigentlichem Schöpfer von Geschichte, als
Vor-Denker der großen, weltgeschichtlichen Verläufe. Geschichte als
Umsetzung der Gedanken, Phantasien und Träume, die sich irgendwann
zuvor in den Künstlern und Denkern abspielen. Melancholiker
erfinden Geschichte, die anderen machen sie. Eine Vorstellung –
großartig und erschreckend zugleich. Subtile Ausmalung einer auf Dauer
gestellten manischen Phase. „Manía“ ist seiner „gewöhnlichen“
Bedeutung nach „Wut, Zorn“ (vgl. das fast synonyme „cholé“). Im Bild
des Schläfers finden wir sie gedämpft. Aber vielleicht gerade deswegen
kann der dauerhaft passivierte Körper des Schlafenden, obgleich
von dienstbaren Geistern betreut, zum Zeugungsorgan der heftigsten
Wunsch- und Albträume werden.
Suche nach der verborgenen Utopie
Wie haben sich diese satumischen Überlieferungen in Dürers Stich
eingetragen?
Wo kommt der melancholische Grundkonflikt zum Ausdruck?
Ich versuche wieder, den Blick des Kindes aufzunehmen, das ich einmal
war: das ausstrahlende Licht am Himmel. Lichter und Schatten
auf der runden Stirn des kleinen Kindes, das auf einem Mühlstein
sitzt Erinnerung an einen sagenumwobenen Mühlstein in der Umgebung
der Kleinstadt, in der Erde versunken, nur noch der obere Rand
schaute hervor, ungefähr so viel, wie das Tuch bedeckt, auf dem das
Kind hockt. Es träumt. Es schreibt auf. Es erweckt den Anschein von
beidem.
Ich verlasse den Blick des Kindes und komme zum Zirkel.
Fast in der Bildmitte: ein kunstvoll ziselierter Zirkel. Wie merkwürdig
die Person damit umgeht! Als wollte sie mit dem einen Ende zeichnen
oder schreiben. Was malt sie mit dem Zirkel ab, und auf was für einer
Fläche steht das spitze Ende mit dem Dorn?
Die ganze Zwie-lichtigkeit des Melancholischen ist auf Dürers Stich
ausgebreitet und setzt sich in den Dingen fort. Das ist auch nur
konsequent. Denn wenn es das melancholische Syndrom nicht nur im
menschlichen Subjekt gibt, sondern wenn es als saturnisches Prinzip
die Welt unterhalb dieses Planeten beherrscht, dann muß sich die
paradoxe Fügung aus Tag und Nacht, aus Licht und Finsternis, auch in
den Gegenständen wiederfinden lassen, in den klugen Geräten
menschlicher Hervorbringung erst recht.
Gerechtigkeit und Zeit hängen an den Wänden eines fensterlosen
Bauwerks. Die Glocke ruft ohne Ton. Die höher gehängten Symbole
gegenüber den tiefer liegenden.
Unter den unteren Werkzeugen nimmt das Sägemesser eine Sonderstellung
ein. Es stellt eine Fortentwicklung des Instruments dar, mit
dem Saturn erst das Genital seines Erzeugers abschnitt, dann damit
den Menschen Unterricht gab für den Weinanbau, für Gras- und
Getreideschnitt.
Nicht weit davon – in den Falten des Gewandes verborgen – der Beutel,
ein viel zitiertes Saturnsymbol. Es steht für Akkumulation in physischer
und psychischer Hinsicht. Akkumulation ist eine besonders
interessante Variante von Hemmung oder Stauung. Die Galle,
eigentlich grüngelb, schwärzt sich. Aus dem Geldstrom wird „Kapital“,
wird eine Erinnerung wach an den kapitolinischen Hügel, an den dortigen
Haupttempel des Saturn, in dem der römische Staatsschatz aufbewahrt
wurde.
Dürer selbst äußert in einer Vorzeichnung desselben Beutels, den er
dann in den Kupferstich gebracht hat, „Beutel bedeutet Macht“.
Ja, und dann lehnt im Bildhintergrund eine Leiter. An ihr entlang
möchte ich den Aufstieg in eine Utopie erwägen, die noch ein Stück
über unsere individuellen Wunschbilder vom königlichen Ich oder
vom Weltgeschichte erträumenden Ich hinausgeht: Eine kollektive
Utopie wie das „Goldene Zeitalter“, der ideale Hintergrund der
Saturnalien.
Dieser Aufstieg ist an der Leiter festzumachen, weil sie viel tauglicher
erscheint als die Flügel der kleinen und der großen Gestalt. Und sonst
führt – von dem Blick der „Melencolia“ einmal abgesehen – nichts aus
dem Bild heraus. Außer der Leiter.
Die Leiter
Leiter bedeutet… – Höhen und Tiefen erreichbar machen, Hindernisse
übersteigen.
Ja, Leiter kann Himmelsleiter bedeuten. Die Leiter im Traum eines
anderen, weltberühmt gewordenen Träumers: Jakobs Traumleiter,auf
der die Boten zwischen Himmel und Erde auf- und abschweben. Kann
bedeuten -…
Im Himmelsgewölbe, durch das Dante in seiner „Göttlichen Komödie“
emporgeführt wird, gibt es an einer Stelle eine Leiter. Auf ihr
wandern die Seligen aufwärts. Ihr Ende verliert sich in unermeßlicher
Höhe.
„Im Sternenspiegel, der die Welt umwandert
und jenes guten Herrschers Namen trägt
der alles Böse unter sich erstickte (= Saturn),
sah ich in goldner, lichtdurchwirkter Farbe
sich eine Leiter nach der Höhe recken,
so fernhin, daß mein Blick ihr nicht mehr folgte.“
„Vid’io uno scaleo eretto in suso / tanto, ehe noi seguiva la mia luce.“
(Dante, Paradiso, 21. Gesang, 25-30)
Aber Dürers Leiter ist leer. Da schwebt niemand. Für einen Himmel,
für einen Traum eine ernüchternd realistische Leiter. Aber wiederum
auch nicht wirklich realistisch, sondern eigentümlich verdreht.
Überall im Bild stimmt die Perspektive, nur bei der Leiter stimmt
irgendwas nicht. Warum eigentlich? Dürer war doch ein Meister in der
perspektivischen Darstellung. Wie kommt solch ein Schnitzer
zustande?
Ich merke, wie ich dann selbst anfange, die Leiter zu verdrehen.
Vorhin war sie noch tauglich zum Aufstieg (und Ausstieg aus dem Bild).
Nun ist sie so verdreht, daß ich nicht herausfinden kann, auf welcher
Seite man aufsteigen müßte. Der Einstieg – schon der Einstieg zum
eigentlichen Aufstieg ist erschwert durch den vielflächigen Marmorklotz.
Der Betrachter kann genau sieben Sprossen zählen. Vielleicht
gibt es noch mehr. Aber sieben sind ganz oder teilweise sichtbar.
Leiter und Siebenzahl enthalten beide einen Wink auf Saturn. Es gibt
einen siebten Himmel, auch eine Metapher für Entrückung, Entzückung
und Glück. Himmelreich, Reich der Himmel lautet eine utopische
Formel, die von den Lehren Jesu her im Abendland große
Verbreitung gefunden hat Sie hat sich auch dort durchgesetzt, wo es
vorher die großen Verheißungen des Elysiums oder die Erwartung
einer Wiederkehr des „Goldenen Zeitalters“ gab. Die Erwartung des
Himmelreichs hat diese vorgängigen Utopien in sich aufgenommen.
So sind sie – im Kern ihrer Verheißungen – ungelöscht geblieben.
„Schabbetai“
Zum Schluß möchte ich auf eine Utopie kommen, von der ich nicht
weiß, ob sie in uns ebenso ungelöscht geblieben ist. Sie entspricht in
vieler Hinsicht den Vorstellungen vom jesuanischen „Reich der Himmel“,
hat damit auch zu tun, in mehrfacher Hinsicht. Sie – oder vielleicht
die Erinnerung daran – wird auch heute noch, weit über den
Erdball verstreut, alle sieben Tage, jeden siebten Tag in der Woche
begangen. .
Dieser Ritus heißt „schabbat“. Wie die Saturnalien ein Abglanz des
„Goldenen Zeitalters“ sind, so ist der Schabbat (bzw. Sabbat) eine Probe,
eine Kostprobe des „ewigen Schabbats“. Das jüdische Vorbild des Juden Jesus,
aus dessen Jenseitsentwurf Glückserfahrungen, wie sie der gläubige
Jude mit dem Schabbat verbindet, sicherlich nicht weggedacht werden
dürfen.
Was sind die charakteristischen Merkmale des Schabbat?
Im sogenannten Alten Testament wird er häufig „ein Zeichen“
genannt: manchmal Erinnerungs-Zeichen, manchmal Bundes-Zeichen.
Innerhalb der sublunaren Zeitrechnung ist der siebte Tag ein Tag wie
jeder andere. Aber dieser Tag allein ist auch Zeichen.
Die Erinnerung zielt an diesem Tag bis auf das biblische Anfangsereignis
zurück, die Schöpfung. Der Schabbat ist eine Wiederaufnahme
des siebten Tages, von dem es so paradox heißt, daß Gott alles
Werk vollendete und sich allen Werkens enthielt. Wie das?
Wie können Vollenden und Enthalten zusammenfallen?
Aber an diesem ersten Schabbat geschieht noch etwas:
„Und es segnete Gott den siebten Tag und er heiligte ihn“, Gen. 2,1 ff.
Dies ist die erste, in der Schöpfung praktizierte Heiligung, die
Heiligung des Schabbat. Am Segen des Schöpfers haben auch die Werktage
und ihre Geschöpfe teil, aber an der „Heiligung“ einzig und allein
der Schabbat
„Heiligung“ ist eine sehr abstrakt klingende Auszeichnung. Gott
heiligt. Aber auch die Menschen sollen heiligen. Wie geht denn das vor
sich?
Anstelle einer Antwort möchte ich auf einige ganz äußerliche und
formalen Aspekte hinweisen, die für die Schabbatheiligung =
Schabbatfeier wichtig sind, in der Hoffnung, daß sie uns verständlich
werden. Denn ich möchte davon ausgehen, daß uns – so weit wir keine
„praktizierenden“ Juden sind – als Erfahrung ohnehin nur die „pro-
fane“ Außenseite des „sakralen“ jüdischen Bereiches Schabbat
zugänglich ist
Damit haben wir auch schon die erste äußerliche Wirkung einer
Heiligung angesprochen: die Sonderung oder Separation.
Die heilige Zeit ist abgehoben von der gewöhnlichen Zeit, der
heilige Raum ist abgetrennt aus dem nicht heiligen Raum.
Entsprechend gibt es im heiligenden Akt eine eingrenzende, bzw.
aussparende Komponente.
Die strikte Formulierung und Einhaltung des Schabbatgebotes wahrt
genau die Differenz zwischen dieser Welt und einer ganz anderen, auf
deren Geschmack man immer neu kommen muß, weil er sich werktagsüber
immer wieder verliert: eine Welt, wie sie sich nach Feierabend
im besten Weinrausch darstellt. Im Midrasch rabba lassen die
jüdischen Weisen Gott (ver)sprechen: „Ich sehe, in dieser Welt ist der
Wein ein Stolperstein für die Menschheit Aber in der Zeit, die da
kommt werde ich ihn zu einem Mittel der Erquickung (object of
rejoicing) machen.“ (Midr.r. z. Lev., Bd.4, S. 161)
Von seiner äußeren Form her ist der Schabbat begrenzt, sogar strikt
begrenzt: er wird von der jüdischen Gemeinde begrüßt, gefeiert und
verabschiedet. Die Verabschiedung drückt das Moment der Abgrenzung
sehr gut aus. Sie heißt im Hebräischen „habdala“, „Unterscheidung“,
weil es um die klare Erkenntnis einer Grenzüberschreitung
geht, zwischen Schabbat und Werktag und Werktag und Schabbat.
So erhält der Schabbat, als ein Zeichen, das in kollektive
Wunschdimensionen verweist (also nicht schon deren Verwirklichung)
seinen umrahmten Ehrenplatz zwischen den Wochentagen.
Zeichen heißt hier:würden die Juden ihren Sabbat aufgeben, dann
müßten sie vielleicht nach und nach auch Erinnerung und Aussicht
verlieren, die im Schabbat lebhaft und erfahrbar miteinander
verknüpft sind.
Ja, und zum Schluß dieses Kapitels bin ich noch eine Aufklärung
schuldig: warum habe ich es „schabbetai“ genannt, wo doch vom
„schabbat“ die Rede war? – Weil „schabbetai“ in der jüdischen
Überlieferung Saturn, den Planeten bezeichnet.
Schabbat und Schabbetai gehen auf eine gemeinsame Wurzel zurück,
übersetzt „ablassen, aufhören, ruhen, ‚feiern'“.
Heiligen und heilen
Insofern wir uns augenblicklich nicht in sakralen Bereichen bewegen,
sondern mit kunsttherapeutischen Problemen befaßt sind, wäre nach
dem Zusammenhang und der Wechselbeziehung von heilen und
heiligen zu fragen.
Hat das eine überhaupt mit dem anderen zu tun?
Wir leben in einer Zeit, in der Sehnsüchte, eigene und fremde, uns und
andere krank und gesund machen. Es ist also wichtig, damit umzugehen.
Aber wie? Ich kenne keine Utopie, in der sie restlos – oder auch
nur mehrheitlich – untergebracht wären, die Wünsche, angstfrei. In
den manischen Phantasien des melancholischen Denkens, das offenbar
auch in den Religionen „mitgedacht“ hat, entdecke ich erstaunliche
Lichtungen, Öffnungen, Ausstiegsmöglichkeiten. Sehr heilsam. Aber
gleich daneben sind die Anstalten, in denen man vom vielen Üben
melancholisch werden kann: Askese, Exerzitien, Abstinenz.
Das deprimiert. Der individuellen Wunschvision kommt nicht so
schnell eine „generelle“ Utopie entgegen.
Ein Beispiel: wie trifft sich heute der Wunsch nach Freiheit von Arbeit
mit der Angst vor und den Schrecken von individueller und totaler
Arbeitslosigkeit? Ist „Vollbeschäftigung“ eine echte Alternative
oder nur eine verkehrte gesellschaftliche Wunschvorstellung?
Die Leiter in den Himmel verbiegt sich unter der Last solcher schweren
Fragen. Statt mit einer klugen Antwort möchte ich mit einem
saturnisch gestimmten „Statement“ schließen. Es findet sich im
Talmudtraktat „Schabbat“, der Fragen der Schabbatregelung
behandelt:
„Jemand, der in der Stunde des Saturn geboren wurde, wird ein
Mensch sein, dessen Pläne vernichtet werden; mancher sagt: Alles,
was man gegen diesen Menschen plant wird vernichtet werden“.
(n. Levy, Wb. d. Talmudim u. Midraschim, Bd.4, S.507)
L i t e r a t u r
Arnheim, R.: Bemerkungen zum Schöpferischen (in: A. Bader, Geisteskrankheit,
bildnerischer Ausdruck und Kunst, Bern/Stuttgart/Wien, 1975, S.60ff.)
Bashir-Hecht, Herma: Der Mensch als Pilger, Stuttgart (Urachhaus), 1985
Becker, D. et al.: Zeitbilder der Technik, Bonn (Dietz Vlg.), 1989
Chevalier, J. / Gheerbrant, A.: Dictionnaire des Symboles, Paris, 1982
Dante Alighieri: Die göttliche Komödie (italienisch und deutsch). Freiburg (Herder),
1956
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie, deutsch v. K.Vossler, München (Piper), 1969
Freud, Sigmund: Trauer und Melancholie. Gesammelte Werke, Bd. 10, Frankfurt a.M.
(Fischer), 1967
lamblichus. Über die Geheimlehren, Schwarzenburg (Ansata), 1978
Kerenyi, Karl: Die Mythologie der Griechen, Bd. l, München (dtv), 1966
Klibansky/Panofsky/SaxI: Saturn und Melancholie, Frankfurt a.M. (Suhrkamp), 1992
Lepenies, Wolf: Melancholie und Gesellschaft, Frankfurt a.M., (Suhrkamp), 1972
Levy, Jacob: Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, Berlin/Wien, 1924
Ley, Willy: Die Himmelskunde. Düsseldorf/Wien (Econ), 1965
Megenberg, Konrad v.: Das Buch der Natur, Hildesheim 1971
Midrash rabba, Vol.4 (Leviticus), London/New York (Soncino), 1983
Nork, F.: Etymologisch-symbolisch-mythologisches Real-Wörterbuch Bd.4, Stuttgart,
1845
Oswalt, Sabine: Concise Encyclopedia of Greek and Roman Mythology,
Glasgow/Chicago (Collins), 1969
Plutarch: Das Mondgesicht, Zürich (Artemis), 1968
Siddur, The Prayer Book, Ed. Rabbis Nosson Scherman / Meir Zlotowitz, Brooklyn
(Mesorah Publ.),1969
Wittkower, M.u.R.: Künstler – Außenseiter der Gesellschaft, Stuttgart (Klett), 1989