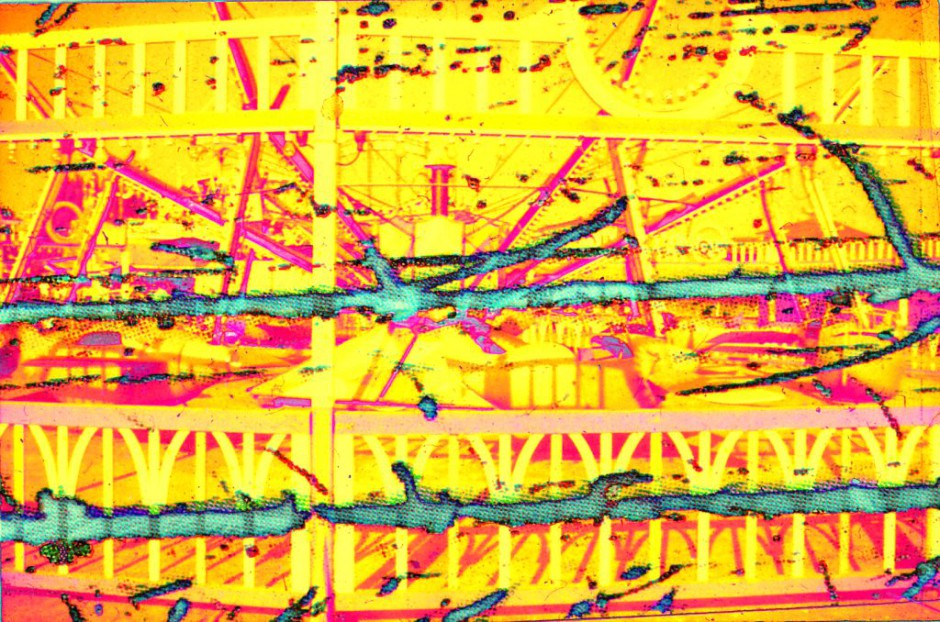Verfasser: Dietmar Becker, zuerst veröffentlicht in GadF 381 II/2007
Graben, pflanzen, schneiden, pflücken, gießen, grillen, trinken, essen, plaudern, flirten, im Schatten oder in der Sonne dösen und vieles andere mehr gehören zu den Tätigkeiten im Garten, die es noch lange geben wird.
Aber eine ganz wesentliche und einst sogar charakteristische Beschäftigung ist inzwischen seltener geworden und vielleicht auch schon ausgestorben. Das ist das Philosophieren im Garten.
Dass es eine regelrechte Gartenphilosophie gibt, dürfte auch den wenigsten Philosophen bekannt sein. Die gartenphilosophische Schule geht auf den vorchristlichen griechischen Denker Epikur zurückführt. Epikur siedelte um 310 v.Chr., damals etwa dreißig Jahre alt, mit einer ständig anwachsenden Schülerschaft von Samos, der Insel seiner Geburt, nach Athen um. Dort erwarb die Gemeinschaft außer Wohngebäuden und Gemeinschaftsräumen auch einen auffallend schönen Garten. „Dieser Teil des Besitzes erschien mit Recht für die Sinnesart und Vorliebe der neuen Gemeinschaft und ihres Stifters so bezeichnend, dass sie im Volksmund bald die ‚Philosophen vom Garten’ hießen.“[i]
Eine kleine Auswahl aus den Werken des Gartenphilosophen Epikur, der diese Angaben entnommen sind, steht seit 1960 in den Bücherregalen des Verfassers. Die darin sichtbaren Anstreichungen wurden im Alter von achtzehn Jahren vorgenommen, ohne die geringste aktuelle Erinnerung daran. Zum Beispiel in der Einleitung die Sätze:
„Ist es die Aufgabe der Philosophie, das Leben überhaupt möglich zu machen, so hat Epikur diese Aufgabe mit voller Klarheit und größtem Ernst ergriffen. Und da wir sehen, dass jedes Lebewesen instinktiv richtig nach dem ihm gemäßen Daseinszustande strebt, in dem es die möglichst größte Fülle des Lebens genießt, kann Philosophie oder Physiologie, wie Epikur gern sagt, d.h. Betrachtung und Ergründung der Natur, nur das Ziel haben, auch dem Menschen die größtmögliche, ruhigste und ungetrübteste Freude (hedoné) des Daseins zu deuten und den Weg zu ihr aufzuzeigen.“[ii]
Griechisch hedoné, was sich am besten mit Lust oder Wonne übersetzen lässt, ist ein Schlüsselbegriff in der Philosophie Epikurs.
Vielleicht wäre das Bändchen mit der Auswahl aus den Schriften des Epikur wieder im Bücherregal verschwunden, trotz des Etiketts „Gartenphilosoph“, wenn da nicht der Klang des Wortes hedoné gewesen wäre, der stutzen ließ und im Gedächtnis eine Resonanz fand: hedoné – sollte das wirklich nur Zufall sein, dass es so ähnlich klang wie das hebräische eden, von dem der erste Garten der Menschheit, der Garten Eden, seinen Namen erhalten hatte? Und hatten nicht beide Worte die identische Bedeutung von Wonne und Lust?
Zufall hin, Zufall her. Auf einmal sprang ein Interesse auf für das mit dem Phänomen Garten offenbar verknüpfte oder ihm sogar einwohnende Lustprinzip. Sollte es eine besondere Bewandtnis damit haben, dass Epikur und seine Gefolgschaft ihre Gedanken und Gedankengänge nicht in Säulenhallen oder Wandelgängen entwickelt hatten,
wie die Stoiker oder die Peripatetiker, sondern inmitten grünender, blühender und im Wandel der Jahreszeiten sich verändernder Gärten? Und sollte dieses spezifische Ambiente in ihrem Philosophieren, insbesondere in ihrem Lustbegriff einen Niederschlag gefunden haben?
In Gesprächen mit Freunden, die in diese Fragestellungen hineingezogen wurden, tauchte die Vermutung auf, dass das Sprießen, Grünen, Knospen und Blühen nicht nur für den Menschen, der den Garten betritt und sich darin aufhält, eine reizvolle Erfahrung bedeutet. Auch für die Naturwesen selbst, für die Kräuter, Sträucher und Bäume, könnten diese Vorgänge lustvoll sein. Es wäre vorstellbar, dass sie eine vegetative oder animalische Lust ausdrücken, die sich dem Menschen, der riechend, sehend, fühlend und miterlebend daran teilhaben kann, mehr oder weniger unmittelbar mitteilt.
Seine Zeitgenossen und auch die nachfolgenden Generationen hat Epikur zunächst einmal mit seiner drastischen Fassung des Lustprinzips vor den Kopf gestoßen:
„Ich wüsste nicht,“ schreibt er in einem Brief an die von ihm geliebte Hetäre Leontion, „ich wüsste nicht, was ich mir überhaupt noch als ein Gut vorstellen kann, wenn ich mir die Lust am Essen und Trinken wegdenke, wenn ich die Liebesgenüsse verabschiede und wenn ich nicht mehr meine Freude haben soll an dem Anhören von Musik und dem Anschauen schöner Kunstgestalten.“[iii]
Schauplatz für die hier aufgeführten Lustbarkeiten ist, um daran noch einmal zu erinnern, das Gartengrundstück in Athen. Hier, unter Bäumen und zwischen Blumen und Sträuchern, im Schatten von Pinien und zwischen dunklen und flammenförmig emporragenden Zypressen kultivierten die Epikureer eine kommunitäre Existenzform, die den Außenstehenden sicherlich viel Anreiz und Stoff zu übler Nachrede gab. Und diese üble Nachrede hat sich bis heute in gewissen oberflächlichen Vorstellungen vom Hedonismus dieser Gemeinschaft und ihrer Lehre erhalten. Ein Philosophenkollege (Epiktet) nennt die Epikureer schlicht „Schweine“. Es werden schauerliche Geschichten erzählt, wonach Epikur sich zweimal des Tages übergeben habe „infolge der Überladung“[iv] – also ein früher Fall von Bulemie. Viele Jahre lang habe er sich wegen seiner Körperfülle nicht vom Tragsessel erheben können, habe in wilder sexueller Gemeinschaft mit mehreren Hetären zusammengelebt und sei überhaupt streitsüchtig, aufschneiderisch, mit einer Sklavenseele ausgestattet gewesen.[v]
Interessant an diesen Berichten ist, dass sie aufgenommen worden sind von Epikurs späterem Biographen und Anhänger Diogenes Laertios. Dieser zitiert zunächst alle üblen Nachreden, um sie dann Stück für Stück durch gegenteilige Zeugnisse zu widerlegen. In diesen erscheint der zuvor als streitsüchtig charakterisierte Philosoph als sanftmütig. Bezeugt wird seine Achtung, seine Menschenliebe, die auch den Sklaven nicht ausschließt oder den mittellosen politischen Flüchtling, dem Zuflucht im Garten der Gemeinschaft gewährt wird. Der Fresser und Säufer entpuppt sich als ein Mensch mit bescheidener Haushaltung. Er und seine Anhänger begnügten sich mit einem kleinen Becher Wein, „im ganzen aber war Wasser ihr Getränk“.[vi]
Bemerkenswert die Notiz, dass Epikur, im Unterschied zu den Häuptern etwa der pythagoreischen oder der frühen christlichen Gemeinde, „nichts wissen wollte von Vereinigung des Einzelvermögens zum Gesamtbesitz“.[vii] Denn seiner Auffassung nach sei die Aufforderung oder Nötigung, alles im großen Topf zusammenzuwerfen, „ein Zeichen von Misstrauen; Misstrauen aber und Freundschaft vertrügen sich nicht miteinander.“[viii]
Auch dieses Verhalten hat den Garten zum Muster, zum Spiegel: unter den pflanzlichen und tierischen Wesen, die dort zusammenleben, gibt es zwar symbiotische Lebensformen, in denen aber das individuelle Moment nicht nur erhalten bleibt, sondern geradezu gesteigert erscheint. Die epikureische Gemeinschaft kennt, wie der Lustgarten, zwar ein Zusammenrücken und sich Zusammendrängen der Einzelwesen, aber keine Zwangskollektivierung. Wie Epikur überhaupt seine leitbildlichen Vorstellungen von Freundschaft, Gemeinschaft, Wechselseitigkeit aus dem Garten gewonnen zu haben scheint, nicht durch bloße Beobachtung, sondern dadurch, dass er und seine Gemeinschaft hauptsächlich im Garten und mit diesem lebten. Dass die epikureische Übertragung des Gartenmodells auf menschliches Gemeinschaftsleben projektive Züge aufweist und von Idealisierungen vorangetragen wurde, mag nachher erörtert werden.
Einen gewaltigen, bis heute fortdauernden Anstoß hat Epikur mit seiner Behauptung erregt: „Es gibt keine Unsterblichkeit (athanasía) der Seele.“ Der durch die Natur bereitgestellte und in ihr gewordene Organismus zerfällt, vermodert, kompostiert. Und mit dem stofflichen Organismus zerfällt und zerstiebt auch die feinstoffliche, ebenfalls aus Atomen bestehende Seele.
Nach epikureischer Ansicht ist „die Seele ein feinteiliger Körper, der sich auf die ganze Körpermasse verteilt, am treffendsten zu vergleichen mit einem von Wärme durchströmten Hauch, bald diesem (dem Hauch), bald jener (der Wärme) ähnlich.“[ix]
Auf den ersten Blick entspricht diese Seelenvorstellung dem klassischen Modell der Psyche als einer Energie (griech. enérgeia) oder Kraft (dýnamis) mit den beiden elementaren Aspekten, dem der Wärme und dem der Bewegung.
Im Unterschied aber zur Mehrzahl der ähnlichen Seelenmodelle, die gegen alle Naturerfahrung eine Unvergänglichkeit dieses „Wesens“ postulieren, halten sich die Epikureer an das, was „die jeweilig sich einstellenden Seelenregungen und Wahrnehmungen“[x] kundtun. Wenn man mit ihnen davon ausgeht, dass „nach unserem Tode von uns Menschen nichts weiter übrig (bleibt) als die zerstreuten, auseinanderflatternden Atome,“[xi] dann drückt sich darin einerseits die Beschränktheit einer Erkenntnis aus, die keine anderen Auskünfte akzeptiert als diejenigen, welche uns sinnliche Wahrnehmung und innerpsychische Sensationen geben. Andrerseits beeindruckt auch die Bescheidenheit, in der die Seele, als zentrale Wahrnehmungsinstanz, sich mit dem Leib solidarisiert und für sich keinen Existenzanspruch erhebt, der über die Vergänglichkeit des Leibes hinausreicht.
„Es gibt keine Unsterblichkeit der Seele“: diese epikureische Auskunft ist für uns, die wir – jedenfalls in der jüdisch-christlichen Tradition – an mehr oder weniger glaubwürdige Jenseitshoffnungen gewöhnt sind, in ihrer Entschiedenheit zugleich befremdlich und plausibel.
Und sie hat, pragmatisch gesehen, unter dem Gesichtspunkt von Lebensklugheit oder Lebensweisheit, einiges gegen sich, aber auch manches für sich.
Auch sie ist am Leben des Gartens orientiert und gewonnen aus dem Zusammenleben mit dessen Geschöpfen, wobei sich das menschliche Subjekt kein Sonderrecht einräumt, kein Privileg beanspruchen mag auf ein wie auch immer geartetes Über-Leben. Unter diesem Gesichtspunkt ist der hier ausgesprochene Verzicht auf Unsterblichkeit Ausdruck einer wirklichen Solidarität des Menschenwesens mit allen Naturwesen, jedenfalls mit denen, die im Garten mit vergemeinschaftet sind.
Nach Epikur ist der Tod und alles, was über ein mögliches Leben danach spekuliert oder fabuliert wird, ein Nichts. Dies macht unsere bängliche und ablenkende Sorge um das Schicksal unserer Seele und der Seelen der uns Nahestehenden, was damit nach dem Tode sein wird, hinfällig.
Und das bedeutet auch: all unsere Spekulationen hinsichtlich Bestrafung oder Belohnung fallen dahin, und zwar schon zu Lebzeiten.
Es gibt kein „Jenseits“, der Tod ist ein Nichts, der uns im Leben nichts angeht.
Vielleicht hat Epikur diesen Schluss aus einer genauen und einfühlenden Beobachtung des pflanzlichen und tierischen Lebens gewonnen, wie es sich in einem Garten vollzieht. Denn auch im Pflanzenreich, und nicht minder im Tierreich, gibt es nur Vergehen und Werden,
Sprießen, Blühen und Welken, also zyklisch sich vollziehende Prozesse, Zeitlichkeit, aus der es kein Ausbrechen gibt in Zustände unveränderter Dauer. Für die Lebewesen, für das lebendige Wesen gibt es keine Ewigkeit, gibt es weder ein seliges noch ein unseliges Nachleben. Und selbst das in eine scheinbare Dauer verlängerte Dasein der Felsbrocken, aus denen im Garten Epikurs der Steingarten hergerichtet war, auch das Dasein der Steine kennt keine Ewigkeit.
Mit der Entmachtung des Todes geht bei Epikur eine Entmachtung übernatürlicher Kräfte oder Gottheiten einher. Er erklärt, dass die Furcht vor Göttern, vor ihrem Zorn und vor ihren Strafen, die uns im Leben wie im Tode bedrohen könnten, völlig unbegründet ist.[xii]
Dabei hat Epikur das Vorhandensein der Götter keineswegs geleugnet. Aber er schreibt ihrer Vollkommenheit die Teilhabe an der Fülle der hedoné zu. Und diese ungetrübte Glückseligkeit ist unvereinbar mit allen Gunst- und Hassgefühlen, die notwendig entstehen müssten, wenn sie sich in die Schicksale und Geschäfte der Menschen mischen und verwickeln lassen würden. Nach Epikurs Ansicht leben die Götter in voller Leidenschaftslosigkeit und Unveränderlichkeit in den Räumen zwischen den Welten, in den „Metakosmien“, lateinisch „Intermundien“.[xiii]
Rache, Mitleid, alle Arten freundlicher oder feindlicher Teilnahme sind den Göttern fern und fremd. In ihrer hedoné sind sie ganz bei sich selbst.
Für Epikur gibt der Garten, als philosophischer Ort, als Ort des Philosophierens schlechthin, den Rahmen und das Bild ab für gelingendes Dasein, für ein gutes und daher auch lustvolles Leben.
Abgeschiedenheit vom Weltgetriebe, von der Marktgeschäftigkeit, von den Intrigenspielen der Politik, zugleich aber Kontakt mit dem vegetativen Leben und der darin und daraus sich mitteilenden vollen Zustimmung zur Diesseitigkeit – ein solches Ambiente bietet die besten Voraussetzungen für die Zustände von Seelenruhe und Glückseligkeit, die dem epikureischen Denken, Handeln und Trachten vorschwebten.
Naturbeobachtung bildete für Epikur die Voraussetzung für die Einsicht in richtiges und menschengemäßes Handeln, das dann fast naturnotwendig zu einem gelingenden Leben führen musste. Philosophie ist für ihn zugleich auch Physiologie, also Erforschung der Lebensvorgänge bei Pflanzen, Tieren und schließlich auch beim Menschen selbst. Und der Garten stellt sich als Ort, als Denk- und Erfahrungslabor zur Verfügung, in dem Natur,
menschliche und außermenschliche Natur erlebt und erkannt werden kann. Da handelt es sich um keine experimentelle Situation, wie sie in den exakten Naturwissenschaften der Neuzeit zur Untersuchung der Natur hergestellt worden sind. Der Garten ist für Epikur kein Experimentierfeld, sondern ein umfriedeter Raum, in dem eine Gruppe von Menschen mit höchst unterschiedlichen Herkünften und Hintergründen Zusammenleben praktiziert. Dem Kreis des Epikurs gehörten, wie gesagt, Sklaven, Dirnen und Besitzlose ebenso an wie Freie, Besitzende, Leute von Stand. Sie alle finden zusammen im Streben nach Wahrheit und Erkenntnis, verbinden und verbünden sich, wachsen zusammen in Entwicklungs- und Entfaltungsprozessen, die mit denen des Gartens in Analogie gesehen werden: „Die Natur hat uns zur Gemeinschaft geschaffen“[xiv]
Diese Entwicklung eines Gemeinschaftssinnes und sozialer Beziehungen, die vorgängige Standes-, Gesellschafts- und Bildungsunterschiede überwinden, hat sicherlich den Geist des Gartens, seine Atmosphäre, man möchte fast sagen, seinen Genius zur Voraussetzung. Aus der Erkenntnis des nicht unbedingt in der freien Natur, aber im umhegten und gepflegten Garten erfolgenden einträchtigen Zusammenlebens von Pflanze, Tier und Baum gewinnt die bunt durcheinandergewürfelte Gruppe von Menschen eine gemeinschaftliche Gestalt. Was sie zusammenführt ist das Interesse an einer Wahrheit, die nicht leer und abstrakt ist, sondern erfüllt und den Wunsch nach vollem Leben einlöst. Genau diese Suche, die individuell und kollektiv erfolgt, gibt ihnen, durch Widerstände und Einwände hindurch, einen Gewinn an Leben und Lust. Paradoxerweise sind es in diesen Lern- und Werdeprozessen immer wieder auch die Phasen vorübergehender Entbehrung, Hemmung, durch irgendwelche Umstände erzwungener Triebaufschub und Anwandlungen von Unlust, die eine Steigerung des Lebenswillens und auch der Lebenslust herbeiführen.
Der Garten wird zur teils unbewusst vorausliegenden, teils auch reflektierten Matrix für ein gelingendes Leben in Gemeinschaft. Die epikureische Gartenkommunität hat natürlich ihre notwendigen Begrenzungen, die sich etwa aus der Abgrenzung gegenüber Markt, Politik und bestimmten Formen von Öffentlichkeit ergeben. Diese Begrenzungen bieten der Gemeinschaft und ihrem Zusammenhalt, dem darin herrschenden Gemeinsinn einen gewissen Schutz. Es sind gleichsam protektive oder protektionistische Maßnahmen, insofern gewiss auch beschränkende Formen. Das epikureische Motto „Lebe (bzw. lebt) zurückgezogen!“ [xv]
hat seinen Preis. Die philosophische, dem diesseitigen Seelenfrieden nachstrebende Gartengemeinschaft schließt sich bis zu einem gewissen Grade vom gesellschaftlichen
Leben aus, das sich in der Polis, in der Wirtschaft, in den Medien, auf der Straße, den Märkten abspielt. Und es wird immer wieder dieses scheinbar externe Treiben und seine Unruhe sein, das sich innerhalb der Gartengemeinschaft, in den einzelnen und zwischen ihnen, störend bemerkbar machen wird. Wir wissen heute, dass scheinbar extern, also im gesellschaftlichen Ganzen auftretende Störungen ihre Entsprechung oder ihren Widerhall finden in individuellen Symptomatiken. Gesellschaftliches Elend, gesellschaftliche Krankheiten lassen sich nicht einfach „draußen“ halten. Das lebendige Individuum und Subjekt wird, auch wenn es in einer autarken Gemeinschaft eingebettet ist, naturnotwendig von gesellschaftlichen Strömungen und Veränderungen miterfasst. Kein Einzelner, keine Kommunität ist eine isolierte Ganzheit.
Die Freiheit, diese „schönste Frucht der Selbstgenügsamkeit“[xvi], ist daher immer wieder gefährdet durch gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Krisen und Erschütterungen, die an der Gemeinschaft nicht spurlos vorbeigehen und ihre Glieder erfassen.
Die Angstfreiheit, um die sich die Epikureer ganz besonders bemühen, lässt sich nicht durch Gartenzäune und manchmal auch nicht durch Gruppenzusammenhalt bewahren.
Seelenruhe und Genügsamkeit sind absolut schützenswerte, aber relativ schwer zu schützende Güter und Errungenschaften.
Immerhin haben sie haben mit psychologischem Scharfsinn einige Mechanismen der Angst aufgedeckt.
Zum Beispiel: „Aus Angst, mit Wenigem auskommen zu müssen, lässt sich der Durchschnittsmensch zu Taten hinreißen, die seine Angst erst recht vermehren.“[xvii]
Oder: „Wer Furcht verbreitet, ist selbst nicht ohne Furcht“.[xviii]
Aber die Frage ist, ob es ihnen damit gelungen ist, diese Ängste und das Angestecktwerden davon auch wirklich auszuschalten.
Fragwürdig ist überdies der von dieser philosophischen Richtung gesehene Gegensatz von Angst und Lust. Epikur lehrt, dass die erwünschte Lust, die ‚hedoné’, in der Furcht, in der Angst ihre Widersacher habe. Unsere gegenwärtigen psychologischen Kenntnisse lassen uns da skeptisch werden. Ist es nicht häufig so, dass Lust Angst nicht nur nicht ausschließt, sondern Angst oder Furcht als Beimischung enthält? Reine Lust ohne jede Beimischung von scheinbar lustfremden Affekten, wie etwa Zorn und Aggressivität, gibt es das überhaupt?
Der Psychoanalytiker Balint hat in seiner wichtigen Schrift „Angstlust und Regression“ am
Phänomen des ‚Thrills’ überzeugend belegt, dass im Psychischen Angst und Lust keineswegs so scharf und säuberlich getrennt sind, wie die Epikureer meinten, sondern sich vielfältig miteinander verbinden, verbünden, vermengen. Jede und jeder von uns kann dazu wahrscheinlich eigene Erfahrungen beitragen.
Gartenbeobachtung und Selbstbetrachtung gehen in der epikureischen Gemeinschaft Hand in Hand. Sie machen das Gemeinschaftsunternehmen „Garten“ zu einem von Anfang bis Ende lohnenden Projekt. „Bei den anderen Unternehmungen folgt der Lohn im besten Falle dann, wenn sie zu ihrer Vollendung gekommen sind, bei der Philosophie (im Garten) aber läuft die Freude von Anfang an mit der Erkenntnis mit. Denn der Genuss kommt nicht nach dem Lernen, sondern Lernen und Genuss sind gleichzeitig.“[xix]
Die Wartung des Gartens gibt Erkenntnisse an die Hand, die im Umgang mit sich selbst hilfreich sein können. Dabei gibt es, wie für die Pflege eines Gartens, keine normativ anwendbaren Vorschriften, keine Regeln, die nicht auch immer wieder ausgesetzt werden können oder müssen. Zwar heißt es, die Natur macht keine Sprünge, aber trotzdem sind im Garten wie im Psychischen auftretende Unregelmäßigkeiten, Abweichungen, Widerstände und Brüche an der Tagesordnung. Die von Epikur aufgewiesene Verknüpfung von Lernen und Genießen empfiehlt sich hier als aussichtsreicher Weg.
An die Lehre von der Gleichzeitigkeit von Lernen und Genießen schließt sich eine andere Erkenntnis an: „Das Entstehen des höchsten Gutes und der Genuss daran sind gleichzeitig.“[xx]
Vielleicht ist es auch genau diese Gleichzeitigkeit, eine Art Simultaneitätsprinzip, in dem unterschiedliche Vorgänge und Tätigkeiten, sinnliches Wahrnehmen und Nachsinnen, wackeres Graben und mühsames Grübeln zusammenklingen und in ihrem Einklang ein hohes Lustgefühl wecken oder erzeugen.
Zu guter Letzt hat es den Anschein, dass Garten und Atelier, dass Gartenarbeit und Kunstarbeit, Gärtnern und künstlerisches Gestalten geeignet sind, derartige Erlebnisse und Erfahrungen von Einklang, von Stimmigkeit und Übereinstimmung zu begünstigen oder überhaupt erst möglich zu machen.
[i] Epikur – Philosophie der Freude, übersetzt, erläutert und eingeleitet von Johannes Mewaldt, Stuttgart: Kröner 1956, 18
[ii] Epikur, 24
[iii] Diogenes Laertius, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, Hamburg: Meiner 1967, X 3-6, S. 225
[iv] Diogenes Laertius, X 3-6, S. 226
[v] Diogenes Laertius, X 3-6, S. 226
[vi] Diogenes Laertios, X 10, S. 228
[vii] Diogenes Laertios, X 10, S. 228
[viii] Diogenes Laertios, X 10, S. 228
[ix] Diogenes Laertius, X 63, S. 252
[x] Diogenes Laertius, X 63, S. 261
[xi]Epikur, 27
[xii] Epikur, 28
[xiii] Epikur, 29
[xiv]Epikur, 74
[xv] Epikur, 74
[xvi] Epikur, 72
[xvii] Epikur, 73
[xviii] Epikur, 74
[xix] Antike Geisteswelt, Auswahl und Einführung von Walter Rüegg, Zürich/Stuttgart: Artemis 1964, 638
[xx] Antike Geisteswelt, 640