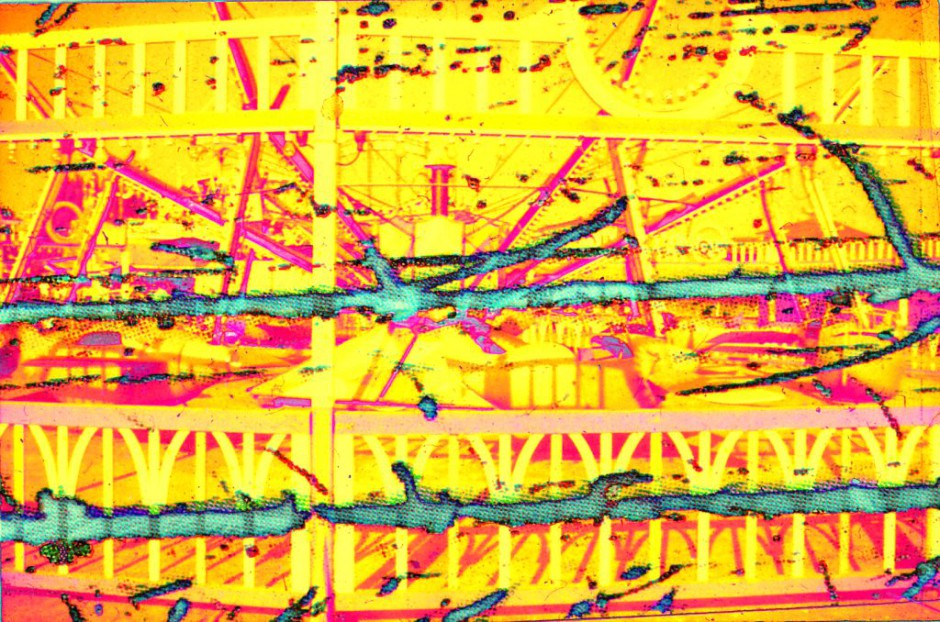Man weiß dieses, man weiß jenes. Aber am wenigsten weiß man, was man selbst gefunden hat. Weil es sich aus unbewusster Suche ergibt, die manchmal ein ganzes Leben anhält. Es gehört ins biographische Kontinuum, ein Thema, das einen nicht los lässt, das einen nicht frei gibt. Die Funde dazu stellen sich ein. Aber irgendwie – vielleicht kommen sie einem zu nahe oder es verlässt dich der Überblick.
Außenstehende, mit der gehörigen Distanz, übersehen die Fundstücke besser. Sie können sie vor allem einordnen, in Ordnung bringen. Das gelingt dem Finder nur in Ausnahmefällen. Er irrt, streunt, verliert sich auf weitem Feld, von seinen nah und fernhin verstreuten Fundsachen umgeben. Vielleicht kennen sie seine Stimme, aber er kennt ihre nicht.
Mit den Funden verhält es sich so, und mit Erfindungen ganz ähnlich.
Es gibt die bescheidenen Finder. Sie sagen, wer das wohl verloren haben mag, wonach ich mich gerade bücke? Einem ehrlichen Finder lässt es keine Ruhe, bis der Beweis erbracht ist, dass der Fund denjenigen, die die Sache liegen gelassen haben, nicht mehr zuzustellen ist. Dann fügen sie sich in den Gang der Welt, wonach etwas seinen Sinn daraus erlangt, dass es verloren gehen muss, um gefunden zu werden.
„Ich weiß nichts, und am wenigsten weiß ich, was ich selbst gefunden habe.
Was bedeutet das? Dass ich es wiederfinden muss? Oder dass es nur Sinn hat, wenn andre es jetzt wiederfinden?“ *
Geistiges Eigentum gibt es nicht, und schon gar kein „rechtmäßiges“. Nicht einmal ein irgendwie zu sicherndes Besitzen. Aber Abgeben und Abnehmen, das sich in Verlieren und Finden ausdrückt, die kontinuierlichste Form von Teilhabe und Anteilnahme.
*) E. Canetti, Nachträge aus Hampstead, 77