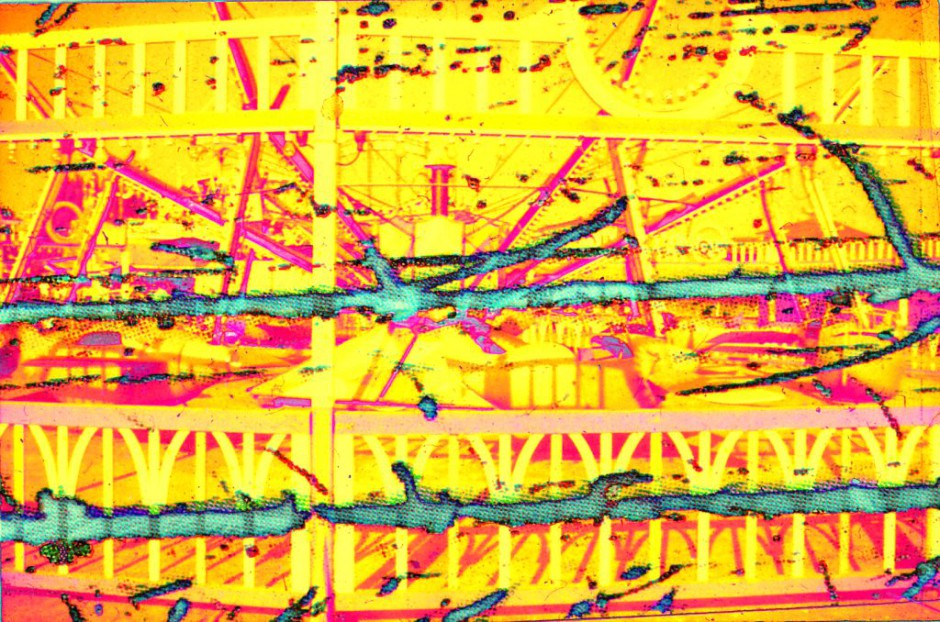Keineswegs alle, aber manche träumen davon, zu dichten. Sie schreiben von den Dächern im Glas, vom Moos, das sich den triefenden Abflussrohren anheftet.
Alle werdenden Dichter lieben das Gras, das zwischen
Ritzen und Stufen wächst.
Sie beobachten den Sonnenaufgang.
Wolkenzug und Vogelschwärme sind immer noch im Schwange
und sind das so lange schon, dass es einem die
winzige Stimme verschlägt.
Je mehr ich dichte, umso winziger schrumpft die Nussschale, die ich mit meinen kleinen Verwirrungen, Zwängen und Sorgen bewohne,
als Wohnstube, Schreibtisch und Küche.
Und das Meer allerorten, das auf einmal ungestüm und riesengroß da ist, wirft mich hin und her in seinem Bauche und fahndet noch immer nach Jonas und anderen Dingen, mit denen ich gar nichts zu tun habe.
Womit soll man den Zorn, die Enttäuschung, die brotlosen Künste, die letzten Bitten des verstorbenen Urenkels abfinden?
Oder kann man dem Suppenkasper oder der faulen Trine andere Worte in den Mund legen, als sie in den verrutschten Zeilen unsrer alten Kinderkehrlieder
immer schon gesungen stehen, still und stocksteif?
Stündlich und lebenslänglich kämpft ein Poet mit und
gegen den Stoff, den er schreibt. Und es wird nicht weniger davon. Es nimmt überhand.
Schließlich gerät er in die Gestalt von Windmühlen, in die traurige Gestalt flügellahmer Windmühlen.
Bis dann aus seinen Ohren die Bäume herauswachsen, mit sturmzerzaustem Gezweig, rauschend und voll von dem Lärm, der sich einst in Kanälen und Straßen, in Traufen und Kabeln abspielte.