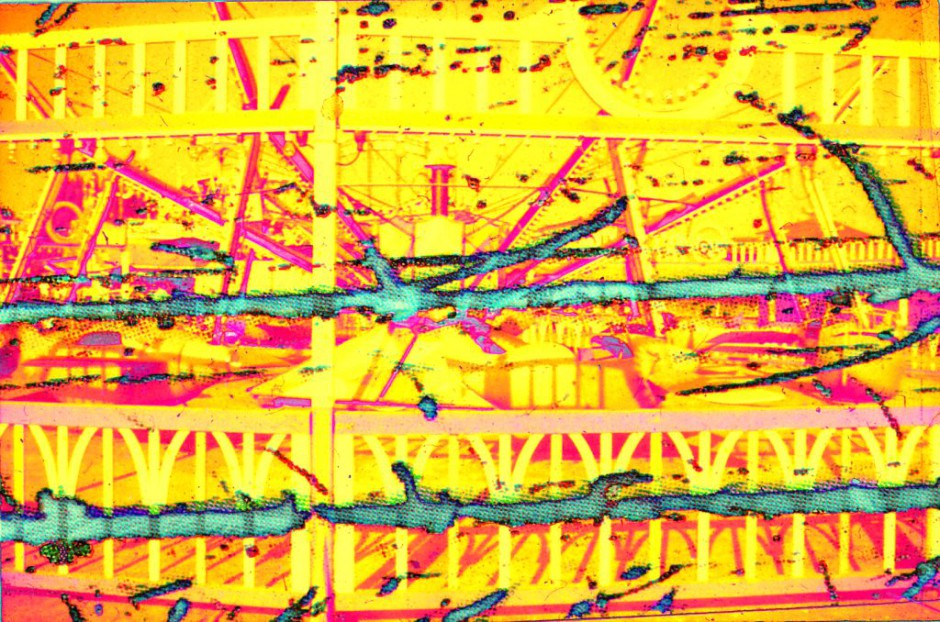In seiner „Ars poetica“ stellt Horaz die These auf, „ut pictura poesis“, d.h. „Malerei (sei) wie (die) Poesie“. Die hier beschworene Ähnlichkeit von Malerei und Dichtkunst hat die ästhetische Theorie seit der Renaissance beschäftigt.
Wir wollen Horaz’ Behauptung erweitern und sie auf das Verhältnis von Bildkunst und Tonkunst übertragen: „ut pictura musica“.
Wenn „Malerei auf die Evidenz des Zeigens angewiesen“[1] ist, so die Musik auf das Hörerlebnis, eine Art des Deutens und Auslegens, das irgendwo zwischen den Ohren ansetzt.
Haben wir nicht schon bemerkt und gesehen, dass auch unser Hörsinn lesen kann? Er liest aus lauter unförmigem Rauschen Klänge und Laute. Überm tönenden Wasser erlauscht man das Schweigen der Fische, den Gesang der Muränen. Am Rand der Forellenteiche ist der Flossenschlag der darin gehaltenen und gezogenen Fische zu vernehmen. Auch sie singen, wenn ihnen danach ist, mit weit geöffneten Mäulern.
Wenn wir, gegen unsere Gewohnheit, auf Bilder nicht nur sehen, sondern auch hören würden, dann könnte es sein, dass das eine oder andere den Song aus sich entlässt, der bei seiner Zeugung in der Luft lag, die Hintergrundsmelodie des Augenblicks seiner Verfassung. Viele Gemälde würden trällern oder pfeifen, ohne an Würde oder Anmut zu verlieren.
[1] Hubert Locher in „Lexikon Kunstwissenschaft“, 364